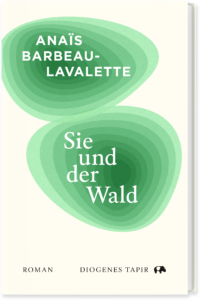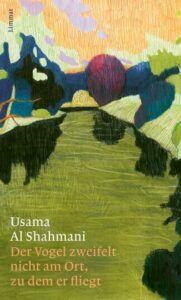In „Sinkende Sterne“ schreibt Thomas Hettche gegen das an, „was die puritanische Welt der Angst, die gerade entsteht, mit ihren Vorstellungen von Schuld und Reinheit zum Verschwinden bringen will“
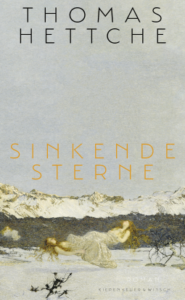 »Wenn wir lesen, Dschamīl«, sagte ich leise, »ist das so, als ob wir jemanden ansähen. Wir schauen einem Fremden ins Gesicht. Und Fremdheit ist fast das Wichtigste an Literatur. Moral hat dabei nichts verloren, gar nichts.«
»Wenn wir lesen, Dschamīl«, sagte ich leise, »ist das so, als ob wir jemanden ansähen. Wir schauen einem Fremden ins Gesicht. Und Fremdheit ist fast das Wichtigste an Literatur. Moral hat dabei nichts verloren, gar nichts.«
Wer sich wie ich über die um sich greifende Bücher-Bereinigung ärgert und diese Eingriffe als gleichsam ahistorisch wie aliterarisch empfindet, wird „Sinkende Sterne“, den neuen Roman von Thomas Hettche, als Plädoyer für die Freiheit der Kunst lesen. Als Zeugen ruft Hettche die berühmtesten Vertreter der Weltliteratur auf und schafft durch geschickt geknüpfte Erzählfäden ein gelehrtes und gut zu lesendes Buch.
Zunächst kommt dieses als Dystopie daher, welche eine durch Klimawandel ausgelöste Naturgewalt beschreibt, die mich an Szenen von Ferdinand Ramuz erinnert. Auch Hettches Roman spielt in den Schweizer Bergen. Ein ungeheurer Bergsturz hat die Rhone gestaut, die Dörfer im Tal versanken in ihrem Wasser, im Oberwallis leben die Menschen seitdem in einer abgeschotteten Welt.
„Seit der Lötschbergtunnel geflutet ist und der Weg talabwärts versperrt, ist es fast wieder wie früher (…) Zwölf Pässe führen aus dem Oberwallis hinaus, Nufenen, Gries, Albrun, Ritter, Simplon, Antrona, Monte Moro und Theodul nach Süden, nach Norden Grimsel, Lötschen und Gemmi und nach Osten die Furka. Doch fast sechs Monate im Jahr sind alle verschneit, und das Tal ist verschlossen.“
In dieses kommt der deutsche Erzähler nicht als Eindringling, sondern auf Anordnung. Ein Ferienchalet, oberhalb von Leuk gelegen, das letzte Domizil seines Vaters, ist nach dessen Tod in seinem Besitz. Da die neu entstandene Gemeinschaft Isolation als Ideal betrachtet, besteht „„Io sono una forza del passato”“ weiterlesen