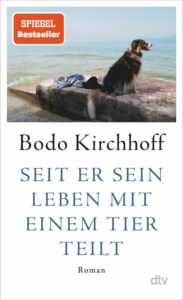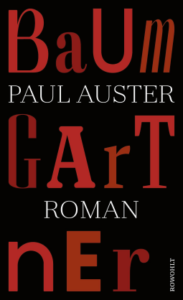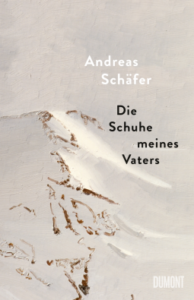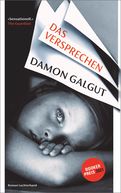Über den Wald als Ort des Werdens und Vergehens schreibt Anaïs Barbeau-Lavalette in „Sie und der Wald“
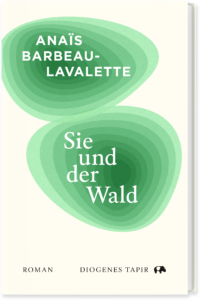 „Ich lasse mich vom Wald aufsaugen. Spüre, dass ich zu diesem Boden dazugehören kann. Zu der Fläche zwischen zwei Bächen, der Biegung hinter dem Felsen, der aussieht wie ein Gesicht, zu dem Erdpfad, der sich zum Gipfel schlängelt. Ich werde für alles durchlässig, das sich bewegt, das bebt. Aber nicht mein Kopf interessiert sich dafür, sondern mein Blut. Der feuchte, süßliche Duft der Balsamtanne, der erdige, intensive Geruch der Eichen. Der perfekt phrasierte Tanz des Perlfarns, der seinem Namen – Onoclea sensibilis – alle Ehre macht, wenn er mit seinen filigranen Zweigen in einer Welle von oben nach unten so elegant mit der Reglosigkeit bricht. Alles ist gleichzeitig hauchzart und üppig. Ich lasse mich verschlucken. Keine Haut mehr zwischen mir und den Bäumen. Ich setze mich auf einen toten Baum, den das Unwetter aus der Erde gerissen hat. Die Berge sind zerfurcht von diesen gewaltigen Narben, wie lauter monumentale Kniefälle vor dem leisen Wüten der jüngsten Zeit. Ein Wald ohne gerade Wege ist ein glücklicher Wald. Er gedeiht prächtig, wenn man im Zickzack zwischen den Bäumen und toten Stümpfen laufen muss, in denen neues Leben gedeiht. Salamandern und unzähligen Insekten bieten sie Unterschlupf und Nahrung. Ein toter Baum trägt genauso zum Lauf des Lebens bei wie ein lebendiger.“
„Ich lasse mich vom Wald aufsaugen. Spüre, dass ich zu diesem Boden dazugehören kann. Zu der Fläche zwischen zwei Bächen, der Biegung hinter dem Felsen, der aussieht wie ein Gesicht, zu dem Erdpfad, der sich zum Gipfel schlängelt. Ich werde für alles durchlässig, das sich bewegt, das bebt. Aber nicht mein Kopf interessiert sich dafür, sondern mein Blut. Der feuchte, süßliche Duft der Balsamtanne, der erdige, intensive Geruch der Eichen. Der perfekt phrasierte Tanz des Perlfarns, der seinem Namen – Onoclea sensibilis – alle Ehre macht, wenn er mit seinen filigranen Zweigen in einer Welle von oben nach unten so elegant mit der Reglosigkeit bricht. Alles ist gleichzeitig hauchzart und üppig. Ich lasse mich verschlucken. Keine Haut mehr zwischen mir und den Bäumen. Ich setze mich auf einen toten Baum, den das Unwetter aus der Erde gerissen hat. Die Berge sind zerfurcht von diesen gewaltigen Narben, wie lauter monumentale Kniefälle vor dem leisen Wüten der jüngsten Zeit. Ein Wald ohne gerade Wege ist ein glücklicher Wald. Er gedeiht prächtig, wenn man im Zickzack zwischen den Bäumen und toten Stümpfen laufen muss, in denen neues Leben gedeiht. Salamandern und unzähligen Insekten bieten sie Unterschlupf und Nahrung. Ein toter Baum trägt genauso zum Lauf des Lebens bei wie ein lebendiger.“
Wer mein Blog verfolgt, weiß, daß ich sehr gerne Bücher über Menschen lese, die sich der Natur aussetzen. Sie dient dem Rückzug, wie bei Howard Axelrod und Doris Knecht oder einem Experiment, wie es Jürgen König auf einer Hochalm unternahm. Manchmal liegt in ihr der einzige Ort zum Überleben, wie in Erwin Uhrmanns spannender Dystopie „Ich bin die Zukunft“.
Eine solche rettende Zuflucht bietet die Natur der in Montréal geborenen Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Schriftstellerin Anaïs Barbeau-Lavalette. Zu Beginn der Corona-Epidemie zieht sie in die kanadischen Wälder. Dort steht das Blaue Haus, wo sie gemeinsam mit ihrem Mann, einem Freundespaar und fünf Kindern die Zeit der Isolation überstehen will. Nicht weit entfernt, aber doch weit genug in Zeiten des Abstands, ist Barbeau-Lavalette im Roten Haus aufgewachsen, wo ihre Eltern nach wie vor leben. „Sie und der Wald“ erzählt folglich von einer authentischen Begebenheit. Wer jedoch denkt, es handele sich um einen Bericht über die Herausforderungen, die Zivilisationsferne „Eros und Thanatos“ weiterlesen