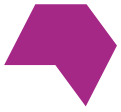„Ab jetzt ist Ruhe “ — Marion Braschs Roman ihrer fabelhaften Familie
“ — Marion Braschs Roman ihrer fabelhaften Familie

 Das ist ein Roman, ein sogenannter biographischer. Eine Autobiographie soll er partout nicht sein, obwohl die Autorin Marion Brasch von sich und ihrer Familie erzählt. Warum? Zu viele Auslassungen, Ungenauigkeiten, Phantasie? Vielleicht, weil nicht alle und alles exakt benannt wurde? Vielleicht, weil manche, der knapp Verklausulierten noch leben und Ungenaues beklagen könnten? Wohl kaum.
Das ist ein Roman, ein sogenannter biographischer. Eine Autobiographie soll er partout nicht sein, obwohl die Autorin Marion Brasch von sich und ihrer Familie erzählt. Warum? Zu viele Auslassungen, Ungenauigkeiten, Phantasie? Vielleicht, weil nicht alle und alles exakt benannt wurde? Vielleicht, weil manche, der knapp Verklausulierten noch leben und Ungenaues beklagen könnten? Wohl kaum.
Der Roman, der seine Hauptfigur Marion Brasch in chronologischer Folge von ihren Eltern, ihren Brüdern und natürlich von sich selbst erzählen lässt, liest sich wie die Geschichte einer Jugend in den Siebzigern und Achtzigern.
Nur fand diese Jugend in der DDR statt, dort wurde Marion Brasch 1961 geboren. Ihre Eltern, überzeugte Kommunisten, die sich im Londoner Exil kennengelernt hatten, emigrierten 1946 in die DDR. Der Vater Horst Brasch machte politische Karriere als stellvertretender Kulturminister, während seine drei heranwachsenden Söhne immer stärker gegen das Regime der SED rebellierten. Die um etliche Jahre jüngere Marion Brasch schildert diese konfliktreiche Familienentwicklung aus der Sicht der kleinen Schwester. Fast über die ganze Länge des Buchs spricht ein Kind, eine Jugendliche, eine junge Erwachsene. Über Politik oder das Leben in der DDR wird folglich kaum reflektiert. Ebenso wenig stehen die Beweggründe des Vaters, dessen politische Überzeugungen im Vordergrund. Über die Brüder, Thomas Brasch, den Schriftsteller und Regisseur, den Schauspieler Klaus Brasch und den Dramatiker Peter Brasch, die sie nicht beim Namen nennt, sondern als älterer, mittlerer und jüngerer Bruder bezeichnet, erfahren wir nicht mehr als bereits bekannt. Im Vordergrund steht die Entwicklung der jungen Frau, ihre Pubertät, der Tod der Mutter und das Zusammenleben mit dem Vater nachdem die Brüder ausgezogen waren. Der Alkohol- und Drogenkonsum der drei Künstlerbrüder nimmt im Buch größeren Raum ein als politische Einstellung oder berufliche Erfolge. Auch die Frauen der Brüder werden mit kindlichem Blick geschildert. Die Schauspielerin mit den wunderschönen, tiefen Augen, die mit warmen Armen und einer kindlichen Stimme, die helle Tänzerin und die mit vielen dunklen Locken und schönem Gesicht, sie tauchen nur am Rande auf. Die flüchtigen Beschreibungen, denen eine Charakterisierung fehlt, machen sie austauschbar. Ebenso wie die vielen Liebschaften der jungen Protagonistin, deren Ende stets auf die gleiche Weise erzählt wird. „Als das Jahr zu Ende ging, ließen wir uns los.”
Marion Braschs Jugend war keine beliebige Jugend in den letzten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts, keine Jugend ist dies je. Aber sie war tragisch, denn das Schicksal bestimmte sie zur Einzigen noch Lebenden ihrer Familie.
Ihre Schilderungen gleichen tagebuchartigen Erinnerungen, sie mögen der Aufarbeitung dienen, aber es fehlt an Tiefe. Sie enden da, wo man gerne mehr gewusst hätte. Unverständlich wirkt die Bezeichnung Roman. In einem Interview bezeichnet die Radiojournalistin Marion Brasch ihre Angst vor der fehlenden Objektivität als Grund keine Biographie gewagt zu haben. Als ob eine Autobiographie eine objektive Angelegenheit wäre. Mehr Subjektivität hingegen hätte nicht geschadet, ein wenig davon findet man in ihrem Weblog, der Bilder und Namen der im Buch erwähnten Freunde und Künstler nachliefert.
Ein leicht lesbarer Roman, der mich entfernt an die Bücher der von mir sehr geschätzten österreichischen Autorin Christine Nöstlinger erinnert. Vielleicht ist es aber auch dieser Sound des Deutschpops, der in Sätzen mitschwingt wie „Wir liebten uns im Dunkeln und dann verliebten wir uns im Hellen“ oder „Alles war gut, bis es nicht mehr gut war“ und den Leser in die Zeit der Achtziger versetzt. Da der Gretchen Sackmeier-Horizont kaum überschritten wird, eignet sich der Roman auch sehr gut als Lektüre für Jugendliche.
 „Im Halbdurchsichtigen drei Nereiden, aus ihren Höhlen am Grunde des Meeres gestiegen, hoch zu ihrem Gott, der auf einem Fabelwesen über Wellen reitet, vorne Pferd, hinten Fisch. Nymphen umkreisen ihn, und er erfleht ihre Gesellschaft, spielt den Schiffbrüchigen, den sie beschützen, besingen, begleiten sollten. Doch die Nymphen treiben andere Spiele. Im Wasser schwesterlich schwebend, sind die Seefrauen, die nur sich selbst unterhalten, in kecken Spielen plaudernd, mit Delfinen singend. Während der Gott um Rettung seiner Mächtigkeit fleht, zwingt er sein Reittier zu einer schaumschlagenden Levade. Poseidon, der Poser! Der Hippokamp trägt in durch die brodelnde Brühe der Geschichte (…)“
„Im Halbdurchsichtigen drei Nereiden, aus ihren Höhlen am Grunde des Meeres gestiegen, hoch zu ihrem Gott, der auf einem Fabelwesen über Wellen reitet, vorne Pferd, hinten Fisch. Nymphen umkreisen ihn, und er erfleht ihre Gesellschaft, spielt den Schiffbrüchigen, den sie beschützen, besingen, begleiten sollten. Doch die Nymphen treiben andere Spiele. Im Wasser schwesterlich schwebend, sind die Seefrauen, die nur sich selbst unterhalten, in kecken Spielen plaudernd, mit Delfinen singend. Während der Gott um Rettung seiner Mächtigkeit fleht, zwingt er sein Reittier zu einer schaumschlagenden Levade. Poseidon, der Poser! Der Hippokamp trägt in durch die brodelnde Brühe der Geschichte (…)“