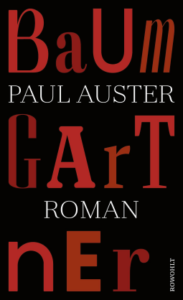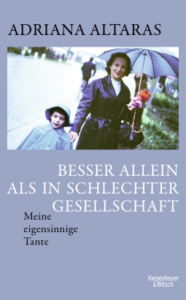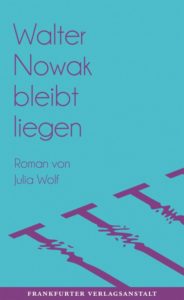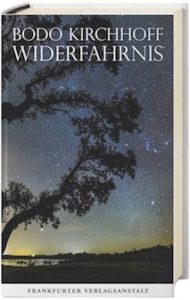Bodo Kirchhoff erforscht in „Seit er sein Leben mit einem Tier teilt” Herzen zwischen Unabhängigkeit und Vertrauen
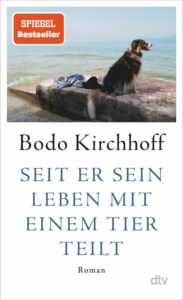 „Nur weil wir jemanden lieben, ist der uns nicht das eigene Glück schuldig.“
„Nur weil wir jemanden lieben, ist der uns nicht das eigene Glück schuldig.“
Das trübe Wetter zu Jahresbeginn ist nur ein Grund zum neuen Roman von Bodo Kirchhoff zu greifen. Dieser trägt zwar den sperrigen Titel „Seit er sein Leben mit einem Tier teilt“, lässt sich aber umso geschmeidiger lesen. Mit Szenen, die sofort einen inneren Film erzeugen, versetzt Kirchhoff seine Leserin an den sommerlichen Gardasee. Eine Gegend, die der Autor sehr gut kennt und bereits zum Schauplatz seines großen Romans „Die Liebe in groben Zügen“ machte. Dieser war 2012 für den Deutschen Buchpreis nominiert, den Kirchhoff unverständlicherweise erst 2016 für „Widerfahrnis“ erhielt. Eigentlich wollte ich nur einen Blick auf den Handlungsort Torri werfen — im neuen Roman einfach nur T. -, als ich das Buch aus dem Regal zog. Doch ich versank erneut darin, weshalb die schon skizzierte Rezension warten musste. Und dann wurde sie gleich noch einmal aufgeschoben, da auch „Wo das Meer beginnt“ nochmals gelesen werden wollten. Angenehmer lässt es sich nicht prokrastinieren.
Italien also, an Ferragosto, nicht direkt unten an den von Touristen überlaufenen Gestaden des Gardasees, sondern in einem Häuschen am Hang, das über steile Pfade erschlossen und für ein Auto schwer erreichbar ist, was die beiden weiblichen Hautfiguren auf verschiedene Weise erfahren. Gleich zu Beginn strandet Frida, die jüngere von beiden, nach missglücktem Wendemanöver in der Einfahrt des Rustico, in dem Louis Arthur Schongauer lebt. Nach dem Tod seiner Frau hat sich der einst in Hollywood für seinen „kalten Blick aus rehbraunen Augen“ begehrte Schauspieler zurückgezogen. Seine einzige Gefährtin, mit der er sich „aus der Zeit und der Erinnerung“ zu stehlen wünscht, ist Ascha, eine Straßenhündin aus Rumänien. Ihre Gesellschaft ist ihm mehr als genügend. Er glaubt, „kein Mensch war je so aufmerksam mir gegenüber. Ascha weiß nicht, dass es die Liebe gibt, aber liebt.“
Schon nach wenigen Zeilen ist man mitten im Geschehen, das Kirchhoff geradezu filmisch inszeniert. Vor bildreicher Kulisse entwickelt er in starken Dialogen Beziehungen zwischen den Protagonisten und ergänzt sie mit Rückblicken voll tiefer Empfindung. Dabei spart er nicht mit feiner Ironie, etwa wenn „Die Unregelmässigkeit des Herzens“ weiterlesen