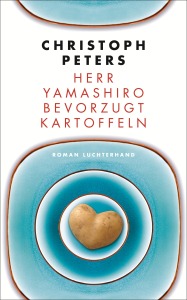„Ich nannte ihn Krawatte “ Milena Michiko Flasar erzählt von Formen der Ausgrenzung
“ Milena Michiko Flasar erzählt von Formen der Ausgrenzung

 „Unsere Freundschaft war der größere Raum, in den ich eingetreten war. Seine Wände hatte ich mit den Bildern derer tapeziert, von denen wir einander erzählt hatten.…“
„Unsere Freundschaft war der größere Raum, in den ich eingetreten war. Seine Wände hatte ich mit den Bildern derer tapeziert, von denen wir einander erzählt hatten.…“
Eigentlich wollte ich diesen Band aus dem Wagenbach-Verlag zunächst nicht lesen. Die Japanbegeisterung ist meine Sache nicht und die Koi-Karpfen auf dem Titel schienen klischeehafte Vorstellungen bestens zu bedienen. Doch die Begeisterung, die ich sowohl in Buzzaldrins Blog wie auch bei der Leselust fand, machte mich neugierig. Vor allem darauf, inwiefern das japanische Phänomen der Hikikomori übertragbar auf europäische Gesellschaftserscheinungen sei. Die in Wien lebende Autorin, Tochter einer Japanerin und eines Österreichers, gibt in ihrem Roman auf diese Frage eine Antwort.
Sie erzählt darin von Hiro, einem jungen Mann, der seit zwei Jahren sein Zimmer im Haus der Eltern nicht verlassen hat. Aus Ekel vor der Welt, vor den Anderen und vor allem vor sich selbst verweigert er sich allem. Auch der Ablenkung. Er will für sich sein, niemandem begegnen, keinem Blickkontakt ausgesetzt sein. Sein einziger einsamer Blick fällt auf einen Riss in der Wand. „Hinter geschlossenen Augen hatte ich seine gebrochene Linie nachgezeichnet. Sie war in meinem Kopf gewesen, hatte sich darin fortgesetzt, war mir ins Herz und die Adern eingegangen.“
Eines Tages wagt er sich dennoch hinaus, druchbricht den selbstgeschmiedeten Käfig und schafft es bis in den Park. Dort auf der Bank bei der Zeder, wo er einst als kleines Kind neben seiner Mutter saß, dort hält er sie aus, die Blicke und Anblicke der Anderen. Kaum erträglich wird es ihm jedoch als die Bank gegenüber von einem Geschäftsmann, einem dieser Krawattenträger, besetzt wird. Dessen Seufzen entlarvt ihn als Lebensmüden, Hiro duldet das Gegenüber eines Gleichgesinnten. Tag für Tag verbringen sie dort auf den Bänken. Vom scheu zugenickten Gruß bis zu gegenseitigen Geständnissen entsteht schließlich Nähe. Sie, die an der Erwartungshaltung der Anderen und ihrer eigenen fast zu Grunde gegangen wären, kommen ins Gespräch und erleben wie ihre Begegnung zu Veränderungen führt. Ihre Erfahrungen mit dem Anderssein, dem inneren, dem sozialen, dem physischen, bedingen das Verhalten. Sie sind alle Hikikomori, denkt Hiro an einer Stelle. Zu viele wählen den Rückzug, den verdeckten, den zeitweisen oder den finalen.
Trotz der Thematisierung der Vereinzelung in unserer Gesellschaft, die vielleicht für die japanische noch stärker gelten mag, aber mir trotzdem universal erscheint, hat Flasar kein bedrückendes Buch geschrieben. In ihrer klaren Sprache schildert sie unpathetisch und in prägnanten Sätzen wie Freundschaft entsteht. In kurzen Kapiteln, die uns die Erinnerungsmomente der beiden Protagonisten näher bringen, begegnen wir dieser Annäherung. Der schmale aber schöne Roman endet mit dem ANFANG, dorthin kehrt man gerne noch einmal zurück um abermals dieses Buch voll wahrer Sätze zu lesen.
Milena Michiko Flasar, Ich nannte ihn Krawatte, Verlag Klaus Wagenbach, 1. Aufl. 2012
 „Mutters Qual. Vaters Qual. Ehemanns Qual.
„Mutters Qual. Vaters Qual. Ehemanns Qual.