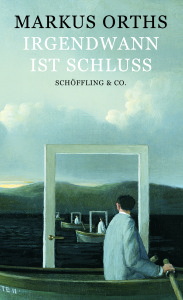„Ja, werfen Sie noch einen letzten Blick zurück, schauen Sie nur, Doktor, da oben haben wir Hyperboreer gelebt, in azurner Einsamkeit, in Höhen, die kein Vogel je erflog, auf dem Dach der klinischen Welt, um Erlösung vom Ekel zu finden. Und ist es nicht schön, dass dieses Dach zugleich auch schon das ganze Haus, pardon die ganze Welt war?“
„Ja, werfen Sie noch einen letzten Blick zurück, schauen Sie nur, Doktor, da oben haben wir Hyperboreer gelebt, in azurner Einsamkeit, in Höhen, die kein Vogel je erflog, auf dem Dach der klinischen Welt, um Erlösung vom Ekel zu finden. Und ist es nicht schön, dass dieses Dach zugleich auch schon das ganze Haus, pardon die ganze Welt war?“
Dieser Satz, der gegen Ende fällt, formuliert das Setting des Romans. An einem enthobenen Ort, einer als Wellness-Ashram getarnten psychiatrischen Klinik, leben Patienten und Ärzte in eigentümlicher Symbiose. Abgeschottet von der übrigen Welt, sofern sie noch existiert, verbringen sie ihre Tage nach salutorischen Maßstäben. Yoga steht auf der Tagesordnung ganz oben, die Laufbänder im hellrosa Ambiente eines Oktagons. Abends wird stilvoll gespeist, tagsüber beruhigen sich die Betreuten mit Rhabarber-Opium, die Betreuer mit einer Zigarette. Zwischen dem Sport, wird Stimmenhören oder Sex verordnet. Falls es gar nicht mehr geht, begibt man sich zwecks Inspektion zum Kernanatom oder direkt auf die letzte Reise.
In dieser Welt doktert Franz von Stern. Ganz auf sich allein gestellt ist er allerdings nie. Sein steter Begleiter ist ein Referent, Ergebnis eines implantierten Über-Ichs, ein persönlicher Regulator, der den geordneten Betrieb durchführt. Dieser soll die Erstarkung des alten Egos mit allen seinen Erinnerungen verhindern, während Stern doch gerade darin herumwühlt um einen guten ersten Satz für den von der Klinikleitung geforderten Eigenbericht zu finden.
Angelika Meier schildert in ihrem zweiten Roman eine Gesundheitsdystopie, deren Bewohner nicht nur medizinisch überwacht und durchleuchtet werden. Dies unternimmt die promovierte Philosophin auf äußerst anregende Weise. Querverweise und Zitate aus allen Bereichen der Kulturgeschichte fordern den Leser und bereiten großes Lesevergnügen.
Bereits die Namen der anwesenden Götter in Weiß amüsieren. Wenn Dr. Tulp, „der beste Kernanatom der klinischen Welt“, den Brustkorb zum Mediatorcheck öffnet, fühlt man sich unweigerlich in die Haarlemer Anatomie versetzt, die Rembrandt einst abbildete. Rembrandts Tulp seziert einen Toten, auch die Körper unter dem Skalpell von Meiers Tulp haben kaum noch Leben in sich. Die gebrochenen Herzen wurden zwischen Därme gebettet und durch ein Mediator-System ersetzt.
Lediglich bei Stern scheint dieses nicht mehr rund zu laufen, er träumt sogar sein früheres Leben. Verstärkt wird dies durch die Begegnung mit einer neuen, ambulanten Patientin, die er als seine frühere Frau erkennt. Grund ihrer Einweisung ist eine akute mangelnde Gesundheitseinsicht und ein durch und durch sympathisches Nervensystem. Nach und nach werden auf dem Klinikhügel weitere Familienbande erkennbar, Sohn, Großvater und Großmutter, die reinste Idylle. Doch dieser will Stern entfliehen, weil sie eben nicht gelebt werden kann.
Angelika Meiers Roman stellt für mich die komplexeste Lektüre seit langem dar. In der Anlage ihrer schizoid anmutenden Figur Stern ergibt sich eine doppelte Erzählperspektive. Mal berichtet der Referent, mal fühlt und erinnert der wahre Stern. So entstehen Rückblenden, in denen sich vermeintlich real Geschehenes mit surreal wirkenden Szenen vermischt. Meiers Sprache ist geistreich und fabelhaft formuliert. Mit mannigfaltigen Referenzen setzt sie ihre Satiren in absurdes Licht. Dies fordert und amüsiert zugleich. Kursiv gesetzt finden sich Zitate von Augustinus, der Bibel, Marx, Puschkin, Rilke und anderen. Mit Arno Schmidt kalauert sie Goethes Italiensehnsucht zu Gen-italien. Eine besondere Referenz erweist die Autorin Gottfried Benn. Sie zitiert nicht nur viele seiner Werke, seiner Novelle Gehirne scheinen die hoch oben gelegene Klinik und der junge Arzt entlehnt.
Meier entwickelt in ihrer Dystopie eine ungeheure Vielfalt an Handlungs- und Wortideen. Zwischen Hallodriegedächtnis und Himmelwasserblau vermischt sie irrwitzigen Medizinjargon mit Therapeutengefasel. Ein schöner Spott über den heilbringenden Gesundheitsglauben und seine Jünger. Er stößt jedoch im Lachen bereits so bitter auf wie zu viel Opium-Rhabarber-Saft. Dieser galt übrigens anno 1814 als Mittel gegen die Ruhr. Darüber kann man bei der Recherche lachen, vorher, also während des Lesens lacht man laut und garantiert über die Quallenpest der Aquagymnastik und den am Beckenrand vorturnenden Arzt. Erst recht über Pfleger Pflügers Fußreflexzonen Fellatio. Sowie schließlich und endlich über die grünschwarz tätowierten schlangengleichen Arme des Schlafforschers und Wachoffiziers Dr. Dankevicz, der seine wahre Berufung in der Phallologie fand.
Eine klitzekleine Kritik habe ich dennoch an diesem Buch, welches ich sicherlich noch einmal lesen werde, da ich längst nicht alles verstanden habe. Asklepios, der griechische Gott der Heilkunst, und somit in diesem Roman gut platziert auf S. 32, besaß zwar den Stab mit der Schlange, eigentlich war er ja selbst eine, aber ganz bestimmt wurde er nicht mit seinen beiden Söhnen, die er nicht besaß, von Schlangen erwürgt. Das war Laokoon, den Asklepios hat Zeus blitzschnell erledigt mit einem Schlag.
Angelika Meier, Heimlich, heimlich mich vergiss, diaphanes, Zürich, 1. Aufl. 2012
Vorläufiges Verzeichnis der Zitate
„Du sinkst augenblicklich ein. Spürst unter dir die träge Last der meterdicken Torfschwämme, den schweren, fetten Leib, der dich umarmt. Ich schließe dich ein, in Wasser, in Erde oder ein Gemenge aus beidem: feuchte Krume, zäher Wurzelfilz, verzweigte Adern über halbverrotteten Ästen wie Knochen, darunter das Herz der Tiefe, breiig, kalt pulsierend, noch vor zweihundert Jahren fürchteten mich die Fenndorfer als schwarzes, schleimiges Tier, das unter den Häusern lebt und ihre Kinder verschlingt.“
. Das Moor ist nicht nur Dions Heimat, es ist „Metamorphosen im Moor“ weiterlesen