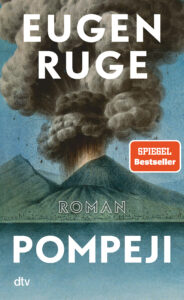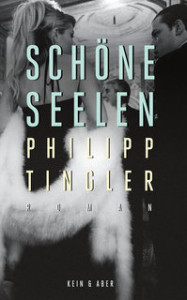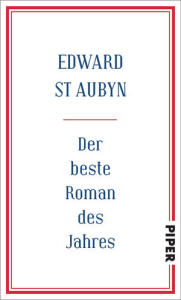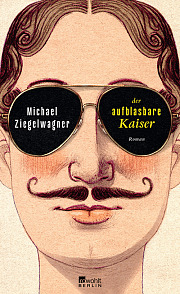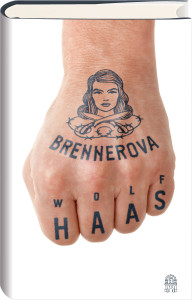In ihrem neuen Roman „Schwindlerinnen“ spielt Kerstin Ekman mit den Lügen der Schriftsteller
 Vom Schwindel befallen weiß man nicht wo oben und unten. Ob links oder rechts, alles dreht sich, die Orientierung ist verwirrt, manchmal ganz und gar verloren. Als Schwindel werden auch Lügen bezeichnet, harmlose, lässliche. Sie offenbaren nicht jedem alles, bergen mindestens ein Geheimnis, sei es auch nur ein kleiner Trick. Aber wer kann schon ohne diese kleinen Tricks leben? Sie dienen der Lebensbewältigung und nicht selten sind sie ein wichtiger Bestandteil des Metiers. Auch Schriftsteller bedienen sich als Illusionskünstler kreativer Schwindeleien, die nicht nur ihr Werk sondern auch ihre Person betreffen. Wenn auch der Großteil der Schreibkünstler inzwischen ihr öffentliches Ego als Bestandteil der Erfolgsstrategie begreift, so gibt es immer noch Autoren, die ihre Anonymität zu wahren wissen. Das Geheimnis um ihre Person scheint der Selbstschutz, ohne den keine Kunst entstehen kann.
Vom Schwindel befallen weiß man nicht wo oben und unten. Ob links oder rechts, alles dreht sich, die Orientierung ist verwirrt, manchmal ganz und gar verloren. Als Schwindel werden auch Lügen bezeichnet, harmlose, lässliche. Sie offenbaren nicht jedem alles, bergen mindestens ein Geheimnis, sei es auch nur ein kleiner Trick. Aber wer kann schon ohne diese kleinen Tricks leben? Sie dienen der Lebensbewältigung und nicht selten sind sie ein wichtiger Bestandteil des Metiers. Auch Schriftsteller bedienen sich als Illusionskünstler kreativer Schwindeleien, die nicht nur ihr Werk sondern auch ihre Person betreffen. Wenn auch der Großteil der Schreibkünstler inzwischen ihr öffentliches Ego als Bestandteil der Erfolgsstrategie begreift, so gibt es immer noch Autoren, die ihre Anonymität zu wahren wissen. Das Geheimnis um ihre Person scheint der Selbstschutz, ohne den keine Kunst entstehen kann.
So ergeht es auch Babro Andersson, kurz Babba, der Schriftstellerin in Kerstin Ekmans „Schwindlerinnen “. Von unattraktivem Äußeren bewegt sich die in einer Arbeiterfamilie großgewordene Babba unsicher zwischen Menschen. Als studierte Philologin bevorzugt sie die Gegenwart der Bücher. Sie arbeitet als Bibliothekarin in der Stadtbücherei, auf deren Karteikarten sie ihre Schreibideen notiert. Als sie eines Tages aus diesen Einfällen eine Geschichte spinnt, schickt ihr Freund diese ohne ihr Wissen an eine Zeitschrift. Das Ablehnungsschreiben offenbart ihr nicht nur den Verrat, sondern ebenso die Erkenntnis, daß sie, Babba Andersson, so wie sie wirklich ist, niemals als Schriftstellerin zu Ruhm gelangen könne. Dazu sei sie nun mal einfach weder flott noch attraktiv genug. „Leute, die schriftstellernde Frauen rühmten, liebten dieses Wort. Frauen sollten flott schreiben. Und rank und schlank sein.“
“. Von unattraktivem Äußeren bewegt sich die in einer Arbeiterfamilie großgewordene Babba unsicher zwischen Menschen. Als studierte Philologin bevorzugt sie die Gegenwart der Bücher. Sie arbeitet als Bibliothekarin in der Stadtbücherei, auf deren Karteikarten sie ihre Schreibideen notiert. Als sie eines Tages aus diesen Einfällen eine Geschichte spinnt, schickt ihr Freund diese ohne ihr Wissen an eine Zeitschrift. Das Ablehnungsschreiben offenbart ihr nicht nur den Verrat, sondern ebenso die Erkenntnis, daß sie, Babba Andersson, so wie sie wirklich ist, niemals als Schriftstellerin zu Ruhm gelangen könne. Dazu sei sie nun mal einfach weder flott noch attraktiv genug. „Leute, die schriftstellernde Frauen rühmten, liebten dieses Wort. Frauen sollten flott schreiben. Und rank und schlank sein.“
Hier kommt die andere Hauptfigur des Romans ins Spiel, Lillemor Troj. Sie erfüllt die aufgestellten Kriterien, weshalb Babba sie zur Stellvertreterin wählt. Sie wird ihr öffentliches Alias, unter ihrem Namen und mit ihrem Gesicht erscheint Babbas Literatur. Lillemor ist nicht nur äußerst vorzeigbar. Als Tochter aus gutem Haus weiß sie sich auf öffentlichem Parkett zu bewegen. Perfekt in Mode wie Manieren bewältigt sie den schriftstellerischen Smalltalk. Zudem tippt und redigiert sie, was Babba auf die Seiten des Spiralblocks schreibt. Lillemor achtet auf Logik und Struktur und spätestens, wenn beide Frauen die Ferienwochen in einer entlegenen Kate im Wald verbringen, wird Lillemor zu Babbas Co-Autorin.
Allerdings erfordert ihre gemeinsame Autorschaft immer stärkere Geheimhaltung. Nicht nur die Männer der beiden erweisen sich als Gefahr, auch ihre eigenen Mütter. Immer verdeckt vordergründig die Wahrheitsliebe die eigentlichen egoistischen Antriebe der Neugierigen. Dennoch gelingt es Beiden die Preisgabe ihres Tricks zu verhindern bis sie selbst zu Verrätern werden. In ihrem neuesten Romanentwurf enthüllt Babba die wahre Geschichte und sendet sie unter ihrem eigenen Namen an einen Verlag. Dieser vermutet Lillemor Troj hätte unter Pseudonym ihre Biographie verfasst und vermittelt den Text an deren Verlag, der wiederrum die vermeintliche Autorin damit konfrontiert.
Hier setzt „Schwindlerinnen“ ein. Wir lesen mit Lillemor Kapitel um Kapitel der ungeheuerlichen Wahrheit, die Babba Anderson in der Ich-Perspektive erzählt. Dazwischen erfahren wir, was Lillemor darüber denkt. Ihre Version schildert der allwissende Erzähler. Die Gegenüberstellung dieser beiden Wahrheiten erzeugt nicht nur den großen Reiz der Konstruktion, sondern auch eine Spannung, die durch den immerhin an die 500 Seiten starken Roman trägt. Kerstin Ekman, die in diesem Jahr achtzig Jahre alt wird, und deren vollständiger Name Kerstin Lillemor Hjorth Ekman aus Gründen der Wahrheit nicht unerwähnt bleiben soll, hat einen umfangreichen Roman geschrieben. Immerhin schildert sie über sechzig Jahre eines erfolgreichen Autorinnenlebens oder besser dreier erfolgreicher Autorinnenleben, Babbas, Lillemors, wie ihr eigenes, welches in Facetten in denen ihrer Stellvertreterinnen aufscheint. Wie Lillemor wurde auch Ekman zum Mitglied der Schwedischen Akademie erkoren, besitzt also ausreichende Information um diesen Aspekt in ihrer Literaturbetriebssatire subtil auszuleuchten. Sie zeigt, wie nicht nur in diesem Gremium Preise vergeben und anhand welcher Kriterien Preisträger gemacht werden. In diesem letztendlich politischen Geschäft zählt mehr Schein als Sein. Dies ist wahrlich keine neue Erkenntnis, wird aber in diesem Roman sehr schön in Szene gesetzt. Gleichzeitig gelingt Ekman ein Gesellschaftspanorama, in dem sie ihre Heldinnen von den restriktiven Fünfzigern über die Alternativkultur der nachfolgenden Jahrzehnte bis in die heutige Zeit begleitet. In eine Zeit, in der das Lesen eines richtigen Buches zu einem subversiven Akt werden kann, vor dessen Folgen Babba Anderson warnt:
„Literatur schädigt das Gehirn und vermindert die Fruchtbarkeit.“
Kerstin Ekman, Schwindlerinnen, übers. v. Hedwig Binder, Piper Verlag, 1. Aufl. 2012
 „Aus meiner Vorliebe Literatur wurde Geschichte, aus der Vorliebe aller anderen für Buchhaltung wurde Wirtschaftslehre, und Amerika blieb Amerika. Ich blieb bis zum Abschlussexamen an der Columbia, und nach mutlosem Suhlen im Dunkel der Lehraufträge wurde ich der erste Jude, der jemals vom Corbin College (damals war die Corbin University noch ein schlichtes College) angestellt wurde, und damit meine ich nicht der erste jüdische Dozent mit Aussicht auf Professur am Historischen Seminar des Corbin College, sondern den ersten Juden überhaupt an der gesamten Hochschule – Lehrkörper und, soweit ich das beurteilen konnte, Studentenschaft eingeschlossen.“
„Aus meiner Vorliebe Literatur wurde Geschichte, aus der Vorliebe aller anderen für Buchhaltung wurde Wirtschaftslehre, und Amerika blieb Amerika. Ich blieb bis zum Abschlussexamen an der Columbia, und nach mutlosem Suhlen im Dunkel der Lehraufträge wurde ich der erste Jude, der jemals vom Corbin College (damals war die Corbin University noch ein schlichtes College) angestellt wurde, und damit meine ich nicht der erste jüdische Dozent mit Aussicht auf Professur am Historischen Seminar des Corbin College, sondern den ersten Juden überhaupt an der gesamten Hochschule – Lehrkörper und, soweit ich das beurteilen konnte, Studentenschaft eingeschlossen.“