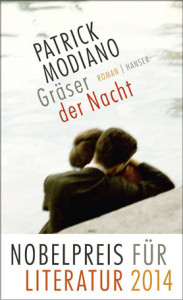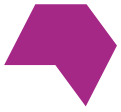Jean Cayrol „Im Bereich einer Nacht“ — Die Wiederentdeckung eines großen französischen Romans
„Und was habe ich in diesem Winkel hier wiedergefunden? Eine verfallene Kindheit, eine niedergehauene Landschaft und über all dem eine wütende, rasende Nacht.“
Anlässlich des hundertsten Geburtstags von Jean Cayrol (1911–2005) hat der Schöffling-Verlag dessen Roman „Im Bereich einer Nacht“ neu aufgelegt, in der beeindruckenden Übersetzung durch Paul Celan.
Der dreißigjährige François ist aus Paris aufgebrochen um seinen Vater zu besuchen. Dieser wohnt in Sainte-Veyres, nach dem Krieg in Chauvigny umbenannt. Man ahnt gleich zu Beginn, daß sich nicht ein freudiges Wiedersehen mit dem Ort und den Personen der Kindheit anbahnt. François verlässt den Zug eine Station vor dem Ziel, um nicht von seinen Vater von Bahnhof abgeholt zu werden und so eine öffentliche Umarmung zu vermeiden. Doch diesen Entschluss bereut er bald. So sehr ihm vor der Begegnung mit dem Vater graut, ängstigt ihn der Fußweg durch die graue, dunkelnde Herbstlandschaft. Er verlässt die Straße wissend sich in diesem „Schierlings- und Brombeerreich“ heillos zu verlaufen.
Die Begegnung mit ein paar Jungs, die nach einen Schatz graben, lösen Erinnerungen an seine eigene, vom Glück weit entfernte Kindheit aus.
„Ich sah ein, daß es unmöglich war, aus eigenen Kräften glücklich zu werden: das war der kunstreich errungene Sieg meines Vaters, die harte Lektion einer knirschenden Mainacht.“
Weiter auf der Suche nach dem rechten Weg durch ein vom Krieg zerstörtes Dorf und seinen Wald, verfolgt von einem herrenlosen Hund, erinnert er sich an seinen letzten Besuch beim Vater, dem „Überwitwer“, der seinen beiden Kindern die Trauer um ihre Mutter verboten hatte.
„Arme Mutter, nie habe ich sie anders gekannt als angeschmiedet an ihren Tod. Vater hatte sie eingekerkert, eingesargt in einem unzugänglichen Kummer. Niemand durfte ihrer gedenken. Nur auf seinen Wink hin durften die Tränen fließen und die Seufzer laut werden. Er gehörte ihm und nur ihm allein, dieser Tod.“
Als einziger Lichtblick in dieser Herbstdämmerung voll schwarzer Melancholie erscheint François sein Glück mit Juliette. Er denkt an ihre erste Begegnung, an ihre bescheidene Wohnung in Paris, in der sie glücklich sein wollen, vor allem, weil sie nicht „den anderen mit irgendwelchen alten Bindungen behelligen“. Die Vergangenheit muss verdrängt werden, um glücklich leben zu können. „Darf man den anderen Dinge aufbürden, die man selbst nicht mehr erträgt?“ François trägt nicht als Einziger eine solche Last mit sich, auch Juliette hat eine Erinnerung zu verschweigen. Deren Zeugen, die Briefe Fernands, könnte sie jedoch mit Leichtigkeit verbrennen. François hingegen holen seine Albträume an jedem Wegweiser ein. Seine einstigen Selbstmordgedanken, die auch den anderen Mitgliedern dieser unglücklichen Familie nicht fern lagen, und die todesnahe Atmosphäre, deren vorherrschendes Element die Angst war.
„Als Kind war ihm kaum etwas anderes beigebracht worden als Angst; eine Angst, der man mit keinerlei Argumenten, mit keinerlei Mut beikam.“ Früchte einer streng religiösen Erziehung. „Dieses Frikassee von Teufeleien, das man uns täglich auftischte.“
Schließlich wird der mittlerweile von Kälte, Hunger und Erinnerungen zermürbte François von einer Autofahrerin aufgelesen. In deren Haus erhält er zwar ein wenig Wärme und einen Cognac, gerät aber zugleich in einen Streit zwischen Vater und Tochter, der ihn schnell seinen Weg fortsetzen lässt. Doch welchen?
„Es gibt immer zwei Wege nebeneinander, einen falschen und einen richtigen. Und Sie – Sie schlagen immer nur die Wege ein, von denen kein Mensch etwas wissen will. Der richtige Weg läuft an den Gleisen entlang. Sie rennen da auf Wegen herum, als ob Sie auf Amseln aus wären, wie die Kinder.“
François’ Weg zurück führt weiter durch seine Kindheit, die er gemeinsam mit seiner Schwester hinter verschlossenen Türen verbringen musste, nur einmal durften sie einen unbeschwerten Tag in Freiheit erleben. Da zeigt sich dem erwachsenen François plötzlich ein Licht in der Dunkelheit, er wähnt sich in Sicherheit, imaginiert eine „anheimelnde, rege, heitere Wohnstätte“, formuliert schon den Bericht seiner nächtlichen, unheimliche Irrfahrt an Juliette, als er beim Betreten des Hauses gefragt wird, ob er wegen des Toten komme. Voller Schreck, von abermaligen Erinnerungen überwältig, verliert er das Bewusstsein. Die Bewohner betten ihn auf ein Sofa und bieten ihm an über Nacht zu bleiben. Vom Nebenraum aus lauscht er den Gesprächen der Frauen, erfährt von ihrem Unglück und, daß der Tote nur zu Besuch war. Sein Unwohlsein lässt ihn in Fieberphantasien fallen, die seine Kindheit heraufbeschwören und ihn fragen lassen, ob der Tod seines Vaters ihn endgültig befreien würde, ob er dann mit Juliette ein neues Leben anfangen könne oder ob er durch die Befreiung vom Verursacher seines Kindheitsunglücks gleichzeitig auch seine Kindheit selbst verlieren würde.
Wieder erwacht hört er die Schneiderin Raymonde und ihre Tochter Claire, später trifft Simon ein, und bringt Unfrieden in seine Familie. Eine Familie, die wie sich zeigen wird, schon längst zerstört ist. Auf dem Höhepunkt des Streites mit ihrem Vater Simon, flieht Claire aus dem Haus. François wird aufgefordert bei der Suche zu helfen. Diese gilt allerdings mehr dem teuren Hochzeitskleid, daß Claire zur Probe übergeworfen hatte, als dem jungen Mädchen selbst. François irrt wieder durch die Nacht und findet Claire schließlich in dem Haus, welches ihm als Knaben Zuflucht geboten hat. Das Haus des alten, lieben Lehrers Jean.
Die Lösung seiner Fragen und damit das Ende dieser Nacht erschließt sich ihm und damit auch dem Leser auf der vorletzten Seite des Romans.
Jean Cayrol beschreibt in seinem Werk die nächtliche Odyssee seines Protagonisten François zu einem Ziel, welches er eigentlich gar nicht erreichen will. Immer wieder unterbrechen Erinnerungen an die Schrecken seiner Kindheit die Suche. Fetzen, die sich nach und nach zusammen fügen. Daneben gibt es Gedanken an sein jetziges Leben, seine Liebe zu Juliette. Von ihrer Situation berichtet der Autor in zwei kurzen Kapiteln. Sie zeigen, wie auch sie von einer Erinnerung belastet wird.
Jean Cayrol schildert die Suche nach dem rechten Weg, der sich in einer vom Krieg traumatisierten Gesellschaft nur schwerlich finden lässt. Er führt durch zerstörte Orte und verwilderte Natur, vorbei an verfallenen Häusern und obskuren Begegnungen. Trotz seines bedrückenden Inhalts, fesselt der Roman, leicht und fließend formuliert. Mehrere Bewusstseinsströme kombinierend entwickelt Cayrol ein intensives Psychogramm des Protagonisten. Erfahrung und Phantasie, Fieber und Traum bilden die Wirklichkeit dieser dunklen Nacht der Erinnerung. So erzeugt dieser Roman, dem ich noch viele weitere Leser wünsche, einen ungeheuren Lesesog.
Im Nachwort würdigt die Romanistin Ursula Hennigfeld den Dichter und Verleger Jean Cayrol. Cayrol wurde als Mitglied der Résistance 1943 im Lager Mauthausen interniert, wo er den Mitinhaftierten Gedichte von Racine und Rimbaud, sowie eigene Werke vortrug. Diese erschienen 1997 unter dem Titel „Schattenalarm“. Seit 1949 war Cayrol verlegerisch tätig. 1973 wurde er Mitglied der Académie Goncourt.
In ihrer Analyse des Romans betont Hennigfeld dessen surrealistische Struktur, sowie die subtextualen Anspielungen auf die Erinnerungspolitik des französischen Staates. Cayrol hat in allen seinen Werken seine Erfahrungen mit Krieg und Shoah verarbeitet, diese aber immer im Literarischen belassen.
Die Freundschaft zwischen Jean Cayrol und Paul Celan, geprägt durch die gemeinsame Arbeit gegen das Vergessen, führte dazu, daß Cayrol Celan um die Übersetzung seines Buches bat. Welche dichterische Freiheit er ihm hierbei ließ, erläutert die Autorin.
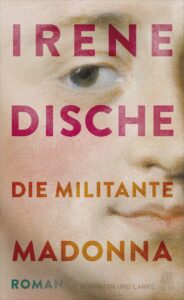 „In meiner Zeit kann man die Menschen schon allein an ihren Zähnen auseinanderhalten. In ihrer Zeit sind alle Zähne gleich, und die Schminke wird mit einem Chirurgenmesser aufgetragen. Wenn Sie Ihr Los als Mann oder Frau nicht hinnehmen, schneiden Sie eben etwas ab oder nähen etwas dran. Alle Subtilität wird verbannt. Alle zarten oder strudelnden Unterströmungen werden ignoriert. Und das nennen Sie „Fortschritt“!“
„In meiner Zeit kann man die Menschen schon allein an ihren Zähnen auseinanderhalten. In ihrer Zeit sind alle Zähne gleich, und die Schminke wird mit einem Chirurgenmesser aufgetragen. Wenn Sie Ihr Los als Mann oder Frau nicht hinnehmen, schneiden Sie eben etwas ab oder nähen etwas dran. Alle Subtilität wird verbannt. Alle zarten oder strudelnden Unterströmungen werden ignoriert. Und das nennen Sie „Fortschritt“!“