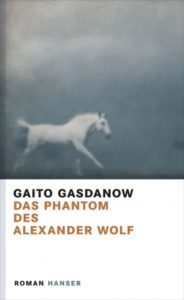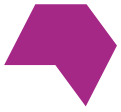Die Metamorphosen der Madame de Guermantes — (Bd. 3, 1)
 Die Erinnerung an eine Person, die für uns von Bedeutung war, verändert sich im Laufe der Zeit. Je länger wir diesem Menschen nicht begegnen um so stärker wandelt er sich zum Ideal, das mit der alltäglichen Person kaum noch übereinstimmt.
Die Erinnerung an eine Person, die für uns von Bedeutung war, verändert sich im Laufe der Zeit. Je länger wir diesem Menschen nicht begegnen um so stärker wandelt er sich zum Ideal, das mit der alltäglichen Person kaum noch übereinstimmt.
So ergeht es auch dem Protagonisten, der im Pariser Palais der Guermantes wohnt und damit in unmittelbarer Nähe dieses Adelsgeschlechtes, dessen Name ihn schon in Combray mit Ehrfurcht erfüllte. Als er Madame de Guermantes, der Frau des Herzogs, zufällig auf der Straße begegnet, ist es ihm unmöglich, sein Bild von dieser Frau mit dem Ideal in Übereinstimmung zu bringen, welches ihn seit ihrem Anblick in der Kirche von Combray besetzt. Das Herausragende wird unversehens zu etwas Alltäglichem, es vollzieht sich eine Desillusion, die er sich als Metamorphose zu erklären versucht. Wie bei Ovid aus einer Nymphe eine Pflanze oder eine Quelle werden kann und diese dadurch ihren ursprünglichen Liebreiz verliert, so verwandelt die reale Alltagssituation den Zauber der Herzogin. Dieser stellt sich jedoch wieder ein, sobald nur noch Erinnerung dieses Bild zusammensetzt. Gehirn und Gefühl rekonstruieren die begehrte Projektion. Und doch verursacht jede neue Begegnung wieder Enttäuschung. Die Banalität des Alltags zerstört das Ideal. Der Faszinierte beobachtet bei Madame de Guermantes einen Hang zur modischen Kleidung, die ihm signalisiert, daß sie auf das Urteil der Passanten Wert legt. „Diese so tief unter ihr stehende Rolle der eleganten Frau“, entspricht nicht seiner Vorstellung von ihrer herausragenden Persönlichkeit. Erst als er sie in der Oper erblickt, nimmt die Kleidung für ihn einen anderen Stellenwert ein. Er deutet sie als Zeichen für die Aufhebung der Metamorphose. Die Robe mit dem pailettenbesetzten Oberteil offenbart die wahre Gestalt der Madame de Guermantes, die Ägis verrät die Minerva. Sie erscheint als Göttin, die bei seinem Anblick allerdings wieder zur Frau wird und ihn lächelnd grüßt.
aus einer Nymphe eine Pflanze oder eine Quelle werden kann und diese dadurch ihren ursprünglichen Liebreiz verliert, so verwandelt die reale Alltagssituation den Zauber der Herzogin. Dieser stellt sich jedoch wieder ein, sobald nur noch Erinnerung dieses Bild zusammensetzt. Gehirn und Gefühl rekonstruieren die begehrte Projektion. Und doch verursacht jede neue Begegnung wieder Enttäuschung. Die Banalität des Alltags zerstört das Ideal. Der Faszinierte beobachtet bei Madame de Guermantes einen Hang zur modischen Kleidung, die ihm signalisiert, daß sie auf das Urteil der Passanten Wert legt. „Diese so tief unter ihr stehende Rolle der eleganten Frau“, entspricht nicht seiner Vorstellung von ihrer herausragenden Persönlichkeit. Erst als er sie in der Oper erblickt, nimmt die Kleidung für ihn einen anderen Stellenwert ein. Er deutet sie als Zeichen für die Aufhebung der Metamorphose. Die Robe mit dem pailettenbesetzten Oberteil offenbart die wahre Gestalt der Madame de Guermantes, die Ägis verrät die Minerva. Sie erscheint als Göttin, die bei seinem Anblick allerdings wieder zur Frau wird und ihn lächelnd grüßt.
Der junge Marcel ist verliebt und dies sofort unglücklich, da er ahnt, daß diese Göttin für ihn unerreichbar bleiben wird. „Ich hatte mich, in Wirklichkeit leider, dafür entschieden, die Frau zu lieben, die vielleicht die größte Zahl von verschiedenartigen Vorteilen auf sich vereinigte und in deren Augen ich deswegen nicht hoffen konnte, auch nur irgendein Ansehen zu genießen; denn sie war ebenso reich wie der Reichste, der daneben nicht auch noch adlig war, ganz zu schweigen von ihrem persönlichen Charme, durch den sie tonangebend und unter allen gewissermaßen die Königin war.“
Wieder einmal hält ihn eine melancholische Liebe in Liebesträumen gefangen. Er versucht die Herzogin auf der Straße abzupassen, unternimmt zur gleichen Zeit seine Spaziergänge, wartet an den Ecken, die sie passieren wird, wartet vergeblich, muss sein Warten verbergen, will nicht auffallen und handelt dadurch vielleicht verkehrt, wenn er bei einer der wenigen Begegnungen, ihre Aufmerksamkeit erregt, jedoch den Gruß nicht erwidert. Sein Versuch nicht aufdringlich zu erscheinen, könnte sie als Unhöflichkeit deuten, was ihn bedrückt. „Warum verspürte ich den gleichen Schauer, heuchelte ich dieselbe Gleichgültigkeit, wandte ich die Augen auf die gleiche zerstreute Weise ab, wie am Vortag, wenn in einer Seitenstraße und unter einer kleinen marineblauen Toque eine Vogelnase im Profil auftauchte, längs einer roten Wange, die von einem stechenden Auge quer durchschnitten wurde, gleichsam die Erscheinung einer ägyptischen Gottheit?“
Seine Angst durchschaut zu werden wächst, Françoise wissender Blick, wenn er morgens die Wohnung verlässt, könnte aus einer Bemerkung der Bediensteten der Herzogin resultieren, die sich abfällig über den „Missetäter“ geäußert haben mag.
Hatte er zu Beginn Madame de Guermantes noch gegen die bisherigen Lieben, Albertine, Gilberte, gar gegen unbekannte reizvolle Mädchen abgewogen, ist dieser Vergleich nun ganz seiner Überzeugung unterlegen, daß diese Guermantes egal in welcher Form sie ihm auch erscheint, seine Göttin ist. „Was ich liebte, war die unsichtbare Person, die das alles in Bewegung setzte, war sie, deren Feindseligkeit ich hätte verjagen wollen.“ Und doch scheint er aussichtslos in seinem unerfüllbaren Verlangen. „Ich liebte Madame de Guermantes wirklich. Das größte Glück, das ich von Gott hätte erbitten können, wäre gewesen, daß er alle nur möglichen Katastrophen auf sie niedergehen lasse und daß sie, (…) , zu mir komme, um bei mir Zuflucht zu suchen.“
Er beschließt über einen Umweg, durch den Besuch bei ihrem Neffen Robert de Saint-Loup, in ihre Nähe zu gelangen. Vielleicht erwähnt ihn Saint-Loup bei seiner Tante, vielleicht kann er sogar eine Begegnung arrangieren? Auch wenn dieser Besuch und die entstehende Freundschaft zu Robert ihn zunächst von seinem Ziel abzulenken scheint, ist seine Sehnsucht stets gegenwärtig. „Es war, als habe eine geschickter Anatom einen Teil meiner Angst entfernt und ihn durch einen gleichen Teil unkörperlichen Schmerzes ersetzt.“ Es stellt sich die gleiche Melancholie ein, die ihn schon früher besetzt hielt, der geringste Anlass weckt seine Erinnerung. „Ein weicher Lufthauch, der vorüber strich, schien mit eine Botschaft von ihr zu bringen wie einst von Gilberte auf den Feldern von Méséglise.“
Saint-Loup verspricht ihn bei seiner Tante einzuführen, doch ein Zwischenfall macht Saint-Loups baldigen Besuch in Paris unwahrscheinlich. Auch Marcels Zeit ist begrenzt, da er zu einem erneuten Aufenthalt in Balbec aufbrechen wird. Um zuvor von Madame de Guermantes empfangen zu werden, erinnert er Robert an seine Begeisterung für die Kunst Elstirs. Da drei seiner Werke sich im Palais Guermantes befinden, bittet er ihn eine Besichtigung zu arrangieren.
Wieder in Paris zögert unser Held seine Spaziergänge aufzunehmen. Er fürchtet Madame de Guermantes zu begegnen, als ob sie ihm alle seine Bemühungen ansehen könnte. Doch er kann seinen Wunsch nicht bezwingen und erfindet Rechtfertigungen, die ihn nötigen das Haus zu verlassen. Wieder weiß er bei den zufälligen Begegnungen nicht, ob er grüßen soll. Seine Hemmungen scheinen gewachsen zu sein. Erschien die Herzogin ihm vor seiner Abreise nach Doncières als eine Gestalt aus dem antiken Götterhimmel, so erscheint sie ihm nun in ihrem Kleid aus hellrotem Samt gleichsam im „mystischen Licht“ einer „Heiligen aus der ersten Zeit der Christenheit“ und damit unerreichbar wie bei der ersten Begegnung im Licht der Kirche von Combray.
Diese empfundene Unerreichbarkeit bestätigt sich auch in der Realität. Saint-Loup kann ihm vorerst keine Einladung bei seiner Tante verschaffen, denn diese sei „gar nicht mehr so nett“.
 „Machen wir also weiter mit dem Greifbaren, dem Spezifischen, dem Alltäglichen: dem roten Rock. Denn so bin ich dem Bild und dem Mann zum ersten Mal begegnet: 2015 in der National Portrait Gallery in London als Leihgabe aus Amerika. (…) Das Modell – der Bürgerliche mit dem italienischen Namen – ist 35, sieht gut aus, trägt einen Bart und schaut selbstbewusst über unsere rechte Schulter.“
„Machen wir also weiter mit dem Greifbaren, dem Spezifischen, dem Alltäglichen: dem roten Rock. Denn so bin ich dem Bild und dem Mann zum ersten Mal begegnet: 2015 in der National Portrait Gallery in London als Leihgabe aus Amerika. (…) Das Modell – der Bürgerliche mit dem italienischen Namen – ist 35, sieht gut aus, trägt einen Bart und schaut selbstbewusst über unsere rechte Schulter.“