Ralph Dutlis eindrucksreicher Künstlerroman Soutines letzte Fahrt
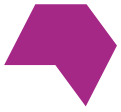 „Sol sajn, as ich boj in der luft majne schlesser.
„Sol sajn, as ich boj in der luft majne schlesser.
Sol sajn, as majn got is in ganzen nischt do.
In trojm wet mir lajchter, in trojm wet mir besser,
In trojm is der himl mir blojer wi blo.“ S. 87
Manche Menschen, die dem Tode nahe waren, beschreiben die überstandene Situation als eine Fahrt ins weiße Licht, während der Stationen ihres Lebens in kürzester Zeit vorüber ziehen.
Das Sterben des jüdischen Malers Chaim Soutine umfasste mehr als die 24 Stunden des 6. Augusts 1943. Versteckt in einem schwarzen Citroën Corbillard, einem Leichenwagen, ging an diesem Tag die Fahrt abseits aller Kontrollen von der Loire nach Paris. Dort sollte in einem Krankenhaus die lebensrettende Operation erfolgen.
Ralph Dutli, der aus der Schweiz stammende Übersetzer und Lyriker, lebt heute in Heidelberg. Er wählte sich für seinen ersten Roman eine historische Person, den 1893 in Russland geborenen Maler Chaim Soutine. Einiges aus der Biographie dieses Künstlers ist historisch belegt. Aber Dutli hat auch Unbekanntes in Archiven gefunden, wovon er in seinem Werk berichtet. Doch es ist ein Roman, den der Schriftsteller mit Eigenem füllt, mit Erlebtem und Erdachtem. Dies gelingt Dutli mit einem Kunstgriff. Soutine wird auf seiner letzten Fahrt nicht nur von seiner Gefährtin Ma-Be, Marie-Berthe Aurenche einstmals Ehefrau von Max Ernst, begleitet. Auch der Morphinmessias ist bei ihm, das Morphium, welches Ma-Be ihm regelmäßig zuführt. Nur so wird der Schmerz erträglich, den Magengeschwür und Bauchfellentzündung verursachen. Aber die Substanz verändert auch das Bewusstsein und beschert Soutine Phantasien und Träume, die dem Schriftsteller die Freiheit schenken über die historische Person in literarischer Form zu schreiben.
Wir lesen von Schmerzzuständen und Erinnerungen, folgen Assoziationen und Räuschen, lauschen Zwiegesprächen und tauchen ein in das damalige Paris. 1913 war Soutine vor dem Elend seiner russischen Heimat in die Stadt der Künstler geflohen, aber auch vor dem Bilderverbot seiner jüdischen Kindheit. Doch im Bienenstock des Alfred Boucher herrschen ebenfalls Hunger und Armut. In diesem aus den Pavillons der letzten Weltausstellung errichteten Gebäude leben viele osteuropäische Künstler, wie Archipenko oder Chagall. Chagall verarbeitet die Motive seiner jüdisch-russischen Jugend, das Schtetl, das Elend, das Pogrom. Soutine will sich daran nicht mehr erinnern, alles hinter sich lassen. Die verhassten Hütten, das Zeichenverbot und die Brüder, die ihn prügelten, weil er seinem Drang zu malen nicht widerstehen konnte. Doch den Traumatisierungen entkommt er nicht. Vielleicht sind sie es, die ihn zur Zerstörung seiner Bilder treiben. Er verbrennt sie, zerfetzt sie mit dem Messer. Auch wenn er seine Motive mit großer Empathie auswählt, „unglückliche Frauen und Kinder ließen ihn zusammenzucken, er erkannte sich in ihnen wieder, da war etwas, was auf ihn übersprang, (…).“
Neben den russischen Künstlerfreunden begegnete Soutine auch Berühmtheiten der Szene, Picasso und Modigliani, der ihn porträtierte und dem Dutli eine besondere Rolle zukommen lässt. Durch ihn entsteht die Verbindung zum Kunsthändler Zborowski, in dessen Räumen der Amerikaner Albert C. Barnes Soutines Bilder entdeckt. Der Sammler kauft alle auf. Soutine hat endlich Erfolg, der sich auch finanziell niederschlägt. Er wird berühmt, aber er bleibt ein Jude, der sich registrieren lassen muss. Der Deportation entgeht er, anders als seine deutsche Lebensgefährtin Gerda Groth, die wie viele politische Flüchtlinge nach Gurs muss. Soutine nannte sie stets Garde, weil ihm der deutsche Klang nicht gefiel. Wie sie zum Paar wurden und was sie verband, lässt Dutli die Beiden auf bewegende Weise erzählen.
Soutine bleibt in Paris, er lernt Ma-Be kennen, versteckt sich, haust mit ihr in Matratzengefängnissen, flieht aufs Land. Aber nicht in den Süden, der noch unbesetzt ist, denn dort gibt es keine Milch. Diese gemischt mit Bismutpulver ist sein Überlebenselixier, ohne das die Magenschmerzen kaum zu ertragen sind. Der jüdische Arzt Tennenbaum, den Garde um Rat bittet, empfiehlt die Flucht und vorerst die Mixtur. Er prophezeit die Verschlimmerung der Schmerzen. Überhaupt der Schmerz, und hier fragt Dutli im Namen des Arztes nach der Theodizee. „Den Schmerz endlich abzuschaffen, wäre die vornehmste Aufgabe eines jeden Gottes, der diesen Namen verdient. Oder nicht verdient.“ Im weißen Jenseits, das Soutine mit Morphium halluziniert, braucht er keine Milch, dort kennt man den Heliobacter und die Möglichkeiten ihn zu bekämpfen. Alles leuchtet weiß, es gibt Milch und Schnee, aber keine Farben. „Im Französischen liegen Farbe und Schmerz so nahe beieinander.“ Couleur et douleur. Weiß macht frei.
Ralph Dutli komponiert in seinem Roman Fakten und Fiktion auf kunstvolle Weise. Er schildert ein Künstlerschicksal mit seinen Traumatisierungen und diskutiert die daraus erwachsenden existentiellen Fragen. Auf dem Weg dorthin passiert der Leser die Situation der Exilkünstler im besetzten Paris und zahlreiche Errungenschaften der Medizin. Die Erläuterung des für das Magengeschwür verantwortlichen Bakteriums und dessen Behandlung gerät sehr ausführlich in diesem ansonsten überzeugenden Roman, der ein veritabler Preiskandidat ist.
In seinem letzten Kapitel erzählt Dutli, der lange in Paris lebte, wie er auf dem Friedhof Montparnass Soutines Grab entdeckte. Chaim Soutine wurde dort am 11. August 1943 von Marie-Berth Aurenche und Gerda Groth sowie von Pablo Picasso, Jean Cocteau und Max Jacobs zur letzten Ruhe geleitet.
Einige Museen, in denen sich Soutines Werke online besichtigen lassen:
Ralph Dutli, Soutines letzte Fahrt, Wallstein Verlag, 1. Aufl. 2013
Liebe Atalante,
dein Kommentar macht mir fast ein wenig „Angst” vor diesem Buch. Halluzinationen in Textform umgesetzt kann ich nur selten gut nachvollziehen… und in der Kunst bin ich leider auch viel zu wenig bewandert.
Würdest du es trotzdem empfehlen, auch für Unbeleckte wie mich?
LG, Daniela
Liebe Daniela, ich möchte das Buch jedem empfehlen, außer Personen, die an Magenschmerzen leiden. Die „Halluzinationen” sind gut zu lesen und vermitteln fehlendes Wissen über Kunst, Medizin, Religion und vieles andere. Wenn sich Halluzination zu bedrohlich anhört, es erwartet Dich kein skurril, wirrer Bewußtseinsstrom, sondern Erinnerungen, die mal hier, mal dorthin führen und bisweilen ein wenig anachronistisch sind.
Ah, danke für diese Erläuterung! Ja, das klingt tatsächlich so, als würde es doch auch zu mir passen. Steht ja ohnehin auf dem Plan — mal sehen, was ich wann wie noch schaffe. Erstmal will ich „Berlin liegt im Osten” zu Ende lesen. Liest du noch an den Sternen?
Im Moment haben Poschmann und Menasse Vorrang. Quasikristalle gefällt mir bisher besser, auch wenn er nicht auf der Longlist steht.
Danke, liebe Atalante! Das Buch werde ich auf jeden Fall lesen, die Leseprobe hat mir auch sehr gut gefallen. Paris, Kunst, Judentum, das sind schon mal Themen, die mich anreizen.
Was ich bei deinen Besprechungen sehr zu schätzen weiß und was auch hier selbstverständlich nicht fehlen sind die Zusatzinformationen zum jeweiligen Thema. Tausend Dank!
Auf deine Meinung zu Poschmann bin ich auch sehr gespannt, die Leseprobe hat bei mir etwas berührt …
Liebe Dana, da ich während der Lektüre des Romans, in dem die Bilder selbst als Protagonisten auftreten, unbedingt wissen wollte, mit wem ich es zu tun habe, war die Suche danach zunächst ganz eigennützig. Wie ja auch eigentlich meine Seite, die ich als eine Art Lesetagebuch begonnen habe. Ich freue mich aber, wenn meine Eindrücke und Fundstücke auch Andere interessieren, und diese Leser sich zu einer Bemerkung hinreißen lassen.
Poschmann ist eines auf jeden Fall, sehr poetisch.