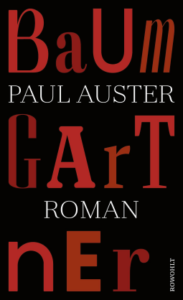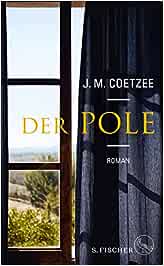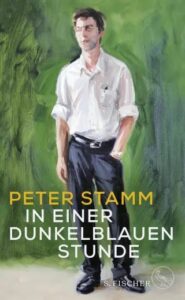Iris Wolff erzählt in „Lichtungen“ von „Zugehörigkeit und Fremdsein“
 „Schon während der Gespräche im Zug war ihm der Gedanke gekommen, dass alle Reisenden auf gewisse Weise ihr Land vertraten. Aber durften einzelne Menschen und Erfahrungen fürs Ganze stehen?“
„Schon während der Gespräche im Zug war ihm der Gedanke gekommen, dass alle Reisenden auf gewisse Weise ihr Land vertraten. Aber durften einzelne Menschen und Erfahrungen fürs Ganze stehen?“
„Ihr Deutschen lebt in der Straße, seid ganz mit eurem Haus verwachsen, zieht die Vorhänge zu, verbergt euch im Hof wie ein Fuchs in seiner Höhle. Wir Rumänen jedoch leben auf der Straße, für jeden sichtbar, ansprechbar. Sollte sich die Straße neigen, wegrutschen, fallen wir mit, rutschen wir mit. Nimmt man euch die Straße, euer Haus, was seid ihr dann? – Noch jetzt traf ihn die Unterscheidung seines Bruders in: wir und ihr.“
„Imre war schweigsam, lebte für sich. Aber nach Levs Ermessen taten dies alle: Bredica, Dorin, Valea, Bunica, Ferry und auch seine Mutter Lis. Das Wesentliche teilten sie nicht. Selbst bei Kato und ihm war das nicht anders, auch wenn er sich das manchmal wünschte.“
Vor kurzem fiel mir auf dem Dachboden ein Tagebuch in die Hand, ich fing an darin zu lesen und blätterte beim letzten Eintrag beginnend zurück. Ganz ähnlich hat Iris Wolff ihren neuen Roman „Lichtungen“ angelegt. Er liest sich wie ein Journal voller Erlebnisse, Beobachtungen und Ideen und erzählt seine Geschichte vom Ende her. Damit dies auch jeder versteht, werden die Kapitel im Countdown gezählt. Zu Beginn steht die Hauptfigur, Lev, mit Mitte 30 am Ende seiner Entwicklung, soweit dies den Roman betrifft. Doch wovon handelt dieser?
Da ist zum einen die Geschichte zwischen dem Mädchen Kato und dem Jungen Lev, die sich als Kinder begegnen und eine Freundschaft zueinander entwickeln, die mit zunehmendem Alter so intensiv wird, daß „Distanzerfahrung“ weiterlesen