Wie Erinnerungen gedeihen — Patrick Modianos „Gräser der Nacht“
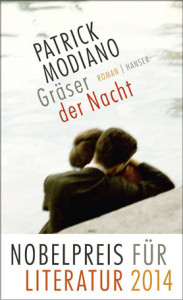 „Du hast eine kurze Zeit deines Lebens – einfach so in den Tag hinein, ohne dir Fragen zu stellen – unter seltsamen Umständen gelebt, umgeben von ebenfalls seltsamen Menschen. Und erst viel später kannst du endlich verstehen, was du erlebt hast und wer diese Menschen aus deiner Umgebung eigentlich waren, vorausgesetzt, man gibt dir endlich die Möglichkeit, eine verschlüsselte Sprache zu entwirren. Die meisten Leute sind nicht in dieser Lage: ihre Erinnerungen sind einfach, geradlinig und genügen sich selbst, und sie brauchen auch nicht zig Jahre, um sie zu erhellen.“
„Du hast eine kurze Zeit deines Lebens – einfach so in den Tag hinein, ohne dir Fragen zu stellen – unter seltsamen Umständen gelebt, umgeben von ebenfalls seltsamen Menschen. Und erst viel später kannst du endlich verstehen, was du erlebt hast und wer diese Menschen aus deiner Umgebung eigentlich waren, vorausgesetzt, man gibt dir endlich die Möglichkeit, eine verschlüsselte Sprache zu entwirren. Die meisten Leute sind nicht in dieser Lage: ihre Erinnerungen sind einfach, geradlinig und genügen sich selbst, und sie brauchen auch nicht zig Jahre, um sie zu erhellen.“
Diesen Erinnerungsprozess beschreibt Patrick Modiano in seinem jüngsten Roman „Gräser der Nacht“. Doch nicht nur der Ich-Erzähler auch der Autor selbst sind Meister des literarischen Erinnerns, wofür der 1945 geborene französische Romancier im zurückliegenden Jahr mit dem Literaturnobelpreis geehrt wurde.
Sein zunächst namenloser Held, dessen Vorname Jean sich erst spät offenbart, rätselt noch immer am Verschwinden seiner einstigen Liebe Dannie. Er betritt Orte der Vergangenheit und taucht durch sie in die zurückliegende Zeit. Doch handelt es sich anders als in Prousts Recherche nicht um eine Mémoire involontaire, die sich unerwartet bei einem ästhetischen Erlebnis öffnet. Der Versuch von Modianos Protagonisten mit Hilfe eines schwarzen Notizbuchs Licht in die Vergangenheit zu bringen, ließe sich besser als Mémoire cherchée bezeichnen. Was dennoch im Dunkeln bleibt und sich nicht mehr finden lässt, ergänzt Jean im Traum. Modiano erweitert so das Proust’sche Trio des Erzählenden, Handelnden und Erinnernden Ichs, um eine weitere narrative Dimension, das Träumende Ich.
Doch der Zugang zur Erinnerung ist dem Ich-Erzähler anfangs versperrt. „Leblos wie ein ausgestopfter Hund“ scheinen ihm die Orte von damals. In der surrealen Stimmung des späten Sonntagnachmittags gelingt es ihm schließlich doch durch eine Bresche in der Zeit zu schlüpfen. Der Anblick einer Fassade, einer bestimmten Adresse, lässt ihn an Paul Chastagnier denken, den Besitzer eines roten Simca, dessen Geruch er imaginiert und der ihm das Vergangene öffnet. Jetzt ist er wieder bei Dannie, der geheimnisvollen jungen Frau, mit der er damals verliebt wenige Wochen verbrachte. Zugleich mit ihr erscheint auch ein kleiner Kreis von Männern aus dem Hotel Unic, zu denen auch Chastagnier zählte und der Marokkaner Aghamouri. Jean fühlte sich unwohl in ihrer Gegenwart, doch lag damals in Paris nicht „überall eine Bedrohung in der Luft und gab dem Leben eine besondere Farbe“?
Damals in den Sechzigern wirkte das Streben nach Demokratie und Freiheit, die ungelösten postkolonialen Konflikte Algeriens und Marokkos bis ins Zentrum der einstigen Kolonialmacht Frankreich. Jean fragt sich, ob Aghamouri, der zunächst im marokkanischen Pavillon der Cité universitaire lebte, wirklich ein Student sei. Wie Dannie zog er dann ins Hotel Unic. Warum warnt ihn der Marokkaner vor Chastagnier und seinen Freunden? Warum berichtet er ihm von Dannies falschem Pass? Sind sie doch ein Paar, fragt sich Jean. Doch Aghamouri erzählt ihm auch von seiner Frau und seinen Kindern, die in einer kleinen Wohnung in Paris leben. Außerdem sind ihm, was Jean Vertrauen fassen läßt, Baudelaire und dessen Geliebte Jeanne Duval nicht unbekannt. Historische Persönlichkeiten über die Jean zu schreiben beabsichtigt, auch zu ihnen finden sich Notizen im schwarzen Heft.
Diese Aufzeichnungen des jungen Schriftstellers enthalten nicht nur die Namen der Straßen und Plätze, die er jetzt wieder abschreitet, nicht nur Namen und Details der früheren Bekannten, sondern auch Recherchen zu einem Roman. Das unvollendete Manuskript ist jedoch verloren, liegen gelassenen beim letzten Besuch in einem Landhaus, dessen Schlüssel Dannie durch mysteriöse Umstände besaß. Manchmal träumt Jean davon, daß der Besitzer dieses Hauses ihm das Manuskript zurücksende.
Vielleicht würde der Text ihm helfen, das Rätsel um Dannie zu lösen? Ihr Verschwinden verwirrt ihn heute noch. Auch wenn seine Vorladung zum Verhör und die Dinge, die er auf dem Kommissariat von Langlais erfuhr, ihm zeigten, daß er Dannie nie wirklich gekannt hatte. Daran ändert sich nichts als Langlais ihm Jahrzehnte später die Akte überlässt.
Zwischen Jeans Begegnung mit Dannie kurz nach 1965 — Elisabeth Edl, die Übersetzerin, verweist in ihrem Nachwort auf die Affäre Ben Barka – und dem Sonntagnachmittag, an dem sich für Jean eine Bresche in der Zeit öffnet – liegen mehr als 40 Jahre, worauf wie nebenbei ein iPhone deutet. Zu den unterschiedlichen Ebenen in der Zeit komponiert Modiano die verschiedenen Weisen des Erinnerns. Vielleicht deutet auch der Titel des Romans „Gräser der Nacht“ darauf, wie die Erinnerung im Traum oder in der Schlaflosigkeit des nachts auf dem Humus des Vergangenen gedeiht?
Auf intensive und spannende Weise lässt Modiano seine Leser an dieser Erinnerungsarbeit teilhaben. Dank der Übersetzung von Elisabeth Edl sind diese Empfindungen auch für deutsche Leser erfahrbar.
„Ja, manchmal ist das Leben eintönig und alltäglich, wie heute, da ich diese Seiten schreibe, um Fluchtlinien zu finden und zu entweichen, durch Breschen in der Zeit.“
________
Einen erhellenden Einblick in Modianos Erinnern und Erzählen bietet Lothar Strucks Essay in Glanz und Elend.