Eugen Ruge ist mit „Pompeji oder Die fünf Reden des Jowna“ der wohl lustigste Roman über die untergegangene Stadt gelungen
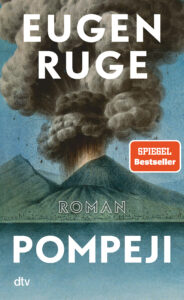 „Ach die Leute.“ Livia zuckte mit den Schultern. „Die sind so vergesslich wie das Schilf! Niemand interessiert sich für das, was du gestern gesagt hast. Sie wollen wissen, was du heute sagst. Die politische Wahrheit, mein Lieber, ist keine Frage von Fakten und Beweisen.“
„Ach die Leute.“ Livia zuckte mit den Schultern. „Die sind so vergesslich wie das Schilf! Niemand interessiert sich für das, was du gestern gesagt hast. Sie wollen wissen, was du heute sagst. Die politische Wahrheit, mein Lieber, ist keine Frage von Fakten und Beweisen.“
„Vergiss, lieber Leser, alles, was du jemals über Pompeji gehört hast.“
Über Pompeji, die im südlichen Kampanien gelegene Provinzstadt, die durch die konservierende Wirkung eines Vulkans im Jahr 79 n. Chr. zu Weltruhm gelang, wurde viel geschrieben. Wissenschaftliches füllt ganze Bibliotheken. Doch auch fiktionale Literatur entstand, kaum hatten die Schatzgräber des Bourbonen-Königs ihre Löcher in die versunkene Stadt gebohrt. Das Erstaunen über die vorgefundenen, annähernd intakten Wohnungen und Stadtstrukturen, insbesondere über die Reste der Pompejaner selbst, die Jahre später Fiorelli durch Gipsausgüsse anschaulich machte, regten die Phantasie vieler Schriftsteller an. Was war wohl geschehen in den letzten Tagen der Stadt? Manchen wie Edward Bulwer-Lytton oder Robert Harris gelang ein Publikumserfolg. Nicht selten trifft man auf an Bestsellern geschulte Experten, die einen über das dekadente Treiben der Pompejaner aufklären.
Da die schriftstellerische Phantasie niemals endet, werden auch weiterhin Romane über Pompeji geschrieben. Der neueste ist aus der Feder von Eugen Ruge und trägt den Titel „Pompeji oder Die fünf Reden des Jowna“. Doch möchte man ihn lesen, wenn man eher die anderen Bücher über die untergegangene Stadt studiert und in manch‘ staubiger Ecke im Anwesen einer pompejanischen Vermieterin herumgestochert hat? Um es kurz zu machen, ja! Alleine, weil Ruges Erzähler Dinge über Iulia Felix ans Licht bringt, die bisher im Verborgenen lagen. Kein Wunder, war er doch dabei und hat den Ausbruch, die Katastrophe, unbeschadet überlebt. Seine Identität offenbart er nicht, aber sein Vorhaben. Er wird, so legt er in einem Prolog dar, die Geschehnisse vor dem Ausbruch aufschreiben, die Papyrusrollen in Amphoren versiegeln und diese verstecken. Die Wahrheit seines Berichts sei den Zeitgenossen nicht zumutbar. Niemand würde ihm glauben. Kein Wunder, daß die Wissenschaft fast 2000 Jahre auf falsche Überlieferungen setzte. Jetzt da die Schriftrollen transkribiert sind, erkennen wir „dies ist der wahre Bericht vom Untergang Pompejis und seiner Bewohner“.
Auf diese Weise legitimiert Eugen Ruge die Ideen seines neuen Romans. Fans historischer Schmöker werden schon im Klappentext gewarnt. Dadurch überredet er die Skeptikerin, diese Quelle zu prüfen. Sie mag sich zu Beginn an Anachronismen stoßen, doch bald wird klar, daß es sich bei diesem Roman ‑oder sollte ich sagen, bei den auf sechs Amphoren aufgeteilten achtzehn Rollen- nicht um den Versuch handelt, Vergangenheit durch Fiktionalisierung erlebbar zu machen. Also nicht um einen Historischen Roman, der mit Mord und Totschlag, Vergewaltigung und schwerer Geburt die Leser bei der Stange hält. Zwar gibt es in Ruges „Pompeji“ auch Sex and Crime, wenn man so will, doch nicht um des wohligen Schauderns vor fernen Vergangenheit willen, sondern um die Satire möglichst saftig zu machen.
Nun habe ich das Pferd von hinten aufgezäumt. Beim Roman ist es ähnlich. Er kann, wie alle Pompeji-Romane vor und nach ihm, das Wissen um das Ende nicht verbergen. Am Schluss bricht der Vesuv aus und verschüttet die Stadt. Da beißt die Maus keinen Faden ab, sei sie auch noch so muskulös.
Beginnen wir also mit der eigentlichen Rezension:
Eugen Ruge, der 2011 mit seinem ersten Roman den Deutschen Buchpreis gewann, weiß, wie man von misslingenden Utopien erzählt. „In Zeiten des zunehmenden Lichts“ schilderte er das Scheitern der sozialistischen Staatsidee anhand eines Familienschicksals in der DDR. In „Pompeji“ dient ihm der Untergang der antiken Stadt als Folie für den Zusammenbruch einer Aussteiger-Kommune. Er erzählt dies am Werdegang ihres Begründers, eines aus Pannonien eingewanderten Jungen, dessen Eltern in Pompeji ihr Glück nicht fanden. Die Metzgerei des Vaters ging zugrunde, ebenso wie dieser selbst. Jowna alias Josephus alias Josse lebt mit seiner Mutter in einer ärmlichen Kammer. Er schlägt sich durch, trainiert auf der Palästra und hängt mit seiner Bande ab. Als diese eine Versammlung belauscht, in der ein gelehrter Grieche vor einer Katastrophe warnt, ergreift Josse seine Chance und das Wort. Er scharrt eine Gruppe von Aussteigern um sich, die von der vom Vulkan bedrohten Stadt fort an einen Strand ziehen. Dort, am „Fenster des Meeres“, wollen sie eine neue Gemeinschaft gründen und Häuser bauen. Schon bald treten, wie bei allen derartigen Projekten, Schwierigkeiten auf. Wie verteilt man Aufgaben und vor allem, wer verteilt sie? Erledigen will sie sowieso keiner. Die Kommunarden üben sich im Abschieben von Verantwortung bis die idyllischen Zustände garstig werden. Da kommt Josse mit einer Idee, auf die er nicht von selbst gekommen ist.
All dies erzählt Ruge mit großem Personal auf den wohlbekannten pompejanischen Schauplätzen. Forum, Palästra, Amphitheater, Thermen, Kneipen und Bordelle werden, wenn nicht alle betreten, so doch erwähnt. Viel lieber treffen sich seine Figuren in den großen pompejanischen Villen, vorwiegend an der Via dell’Abbondanza, wo es nach dem Urin der Färberei stinkt, wo zahlreiche Thermopolien den Bordstein säumen und Iulia Felix ein Anwesen mit allem Drum und Dran besitzt. Man liegt im Triclinium, ‑wenn auch vielleicht nicht ganz so, wie man dort liegen sollte‑, haust in Dachkammen ‑wenn auch vielleicht mit mehr Komfort, einem Herd, als es üblich war‑, und natürlich lässt Mann sich in den Thermen von, wie sollte es anders sein, rothaarigen Sklavinnen die Füße und anderes pflegen. Um nur einige der Anachronismen und Klischees zu nennen, die ich jedoch keinesfalls übelnehme.
Neben den Mitgliedern im Strandlager begegnet die Leserin der raffgierigen Iulia Felix, dem saturierten Fabius Rufus, der einflussreichen Livia Numistria, den Vettiern und einem allwissenden Sklaven. Der ist ebenso vornehm wie hochgestellt, beantwortet wie Alexa Fragen aus dem Nichts, erweist sich als formidabler Spindoctor und heißt zu allem Überfluss auch noch Epiphanes. So schafft Ruge qua Figurenrede vielfältige Perspektiven auf das Geschehen. Es mag überzogen wirken, wenn etwa Livia über den Einsatz verführerischer Roben nachdenkt, und bedient ein Klischee, wenn der „rundgesichtige, teutonische Unterpräfekt“ aus tumber Pflichterfüllung stirbt. Doch diese sind der Satire nun mal eigen. Wenn sie zu schrillen Übertreibungen führen, wie die hautengen Kleider und hohen Schuhe der Livia, denkt man an Ähnliches bei Asterix oder Monty Python. Ruge macht sich über alles lustig, sogar den armen Plinius lässt er nicht aus, und kann doch ernst genommen werden. In zahlreichen Exempeln nimmt er Dinge aufs Korn, die damals wie heute lächerlich erscheinen. Seine Figuren bemühen sich ihre Welt zu erfassen, doch seien sie Philosophen, Strategen, Idealisten oder Egoisten, sie kriegen sie nicht in den Griff und übersehen bei alle dem, die Anzeichen des bevorstehenden Untergangs.
Auch die Kommune am Meer teilt sich schließlich in die, die an ihrer Idee festhalten, und die Kompromissbereiten, die sich arrangieren, um einen Teil ihres Projektes zu verwirklichen. Wären sie eine Partei, könnte sie sich Fundis und Realos nennen. Ihr einstiger Anführer Josse, der arme Sohn eines Einwanderers gelingt mit Geist, Glück und Gelegenheiten eine enorme, wenn auch nicht unerwartete Entwicklung. Eugen Ruge gelingt mit seinem neuen Roman „Pompeji“ eine köstliche Politsatire.
Bleibt am Ende nur zu fragen, wer der allwissende Erzähler ist, der sich die Mühe macht, all‘ dies für die Nachwelt zu erhalten? Dieser Überlebende, der hinter alle Vorhänge blickt und sprachlich gewandt kommentiert, kann nur der kluge Epiphanes sein. Eine wahre Erscheinung!