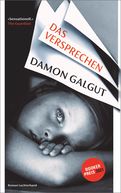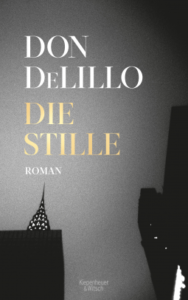„Pornographie“ von Witold Gombrowicz, eine als Farce getarnte Ode
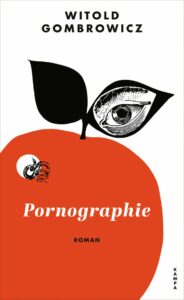 „Der unsichtbare Garten schwoll an und schwelgte in einem Zauber – obwohl feucht, obwohl düster, und mit diesem scheußlichen Verrückten – ich musste tief aufatmen in dieser Frische, badete plötzlich in einem wundervoll bitteren Element, einem zerreißend verführerischen. Wieder wurde alles, alles, alles jung und sinnlich, sogar wir!“
„Der unsichtbare Garten schwoll an und schwelgte in einem Zauber – obwohl feucht, obwohl düster, und mit diesem scheußlichen Verrückten – ich musste tief aufatmen in dieser Frische, badete plötzlich in einem wundervoll bitteren Element, einem zerreißend verführerischen. Wieder wurde alles, alles, alles jung und sinnlich, sogar wir!“
Ob Witold Gombrowicz beim Verfassen dieser Zeilen Szenen erträumte, wie sie auch Max Ernst in seinen Garten- und Dschungelbilder malte? Das kleine Gemälde „Natur im Morgenlicht“ aus dem Städel legt dies nah. Der 1904 geborene Witold Gombrowicz war wie der 13 Jahre ältere Max Ernst dem Dadaismus verbunden. Eine Spur, die sich nicht nur im angeführten Vergleich, sondern an vielen Stellen in Gombrowiczs Roman „Pornographie“ zeigt.
Der Roman entführt in die Natur eines polnischen Landguts, die wie bei Ernst als Dickicht wuchert, in dem Erotik spürbar ist und sich doch nie so recht fassen lässt. Ernst wie Gombrowicz erschaffen Phantasiewelten. Es geht es ihnen nicht alleine um die konkrete Darstellung, diese transportiert vielmehr ihre Auffassung von Kunst. So wie Max Ernst sich als Vogelgestalt in seiner Gartenszene imaginiert, wählt sich auch Witold Gombrowicz mindestens ein Alter Ego in „Pornographie“.
Witold und Fryderyk, zwei Männer um die Sechzig, erhalten 1943 in Warschau die Einladung eines Bekannten, sie auf seinem Landgut zu besuchen. Nichts Großartiges wird sich dort ereignen in der Provinz, die vom Krieg kaum tangiert scheint. Essen, Trinken, Reden, Spazierengehen, dies alles findet, dann doch wieder wegen des Kriegs, auf begrenztem Raum statt. Begrenzt sind auch die Interaktionen der wenigen an diesem kammerspielartigen „An die Jugend“ weiterlesen