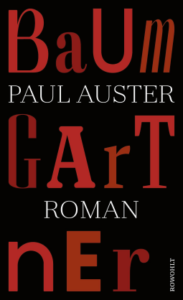In „Kleine Probleme“ von Nele Pollatschek entlädt ein Prokrastinierer seine selbstmitleidige Suada
 „Ich musste oft noch was erledigen, meistens morgen, manchmal aber auch später oder nächste Woche oder demnächst. Das Problem ist, dass es meistens nicht später war, sondern eben jetzt, und jetzt rauchte ich noch eine Zigarette, las noch einen Artikel, starrte auf mein Telefon, wischte dem Weltuntergang hinterher, schaute nur dieses eine Video noch zu Ende, ging nochmal eben aufs Klo, machte schnell noch einen Kaffee, bevor ich dann gleich anfing, also bald, also nachher, also vielleicht doch besser morgen, es war ja auch schon spät. Und dann kamen plötzlich und fast völlig unerwartet diese Momente, an denen das später restlos aufgebraucht war, und aus dem jetzt wurde jetzt oder nie.“
„Ich musste oft noch was erledigen, meistens morgen, manchmal aber auch später oder nächste Woche oder demnächst. Das Problem ist, dass es meistens nicht später war, sondern eben jetzt, und jetzt rauchte ich noch eine Zigarette, las noch einen Artikel, starrte auf mein Telefon, wischte dem Weltuntergang hinterher, schaute nur dieses eine Video noch zu Ende, ging nochmal eben aufs Klo, machte schnell noch einen Kaffee, bevor ich dann gleich anfing, also bald, also nachher, also vielleicht doch besser morgen, es war ja auch schon spät. Und dann kamen plötzlich und fast völlig unerwartet diese Momente, an denen das später restlos aufgebraucht war, und aus dem jetzt wurde jetzt oder nie.“
Im Gegensatz zu den Artikeln der Journalistin Nele Pollatschek, die ich wegen ihres subtilen Humors sehr gerne lese, hat mich ihr Roman „Kleine Probleme“ weniger überzeugt, was sowohl am Thema wie an seiner Ausführung liegt. Der innere Monolog eines Mannes Ende Vierzig zwingt die Leser und erst recht die Leserinnen auf gut 208 Seiten Länge auf das Prokrustesbett. Wenn Lars als wahrer Prokrastinator an den Nerven sägt, will man nur noch eines, ganz weit weg. Das gilt nicht nur für Johanna, die Frau des Anti-Helden flieht vor dessen Verhalten ins ferne Lissabon. Es gilt auch für die Leserin, die diese Lektüre vor große Probleme stellte. Sie war genervt, aufgebracht und schließlich so gelangweilt, daß sie deren Fortsetzung aufgeschoben, aber dennoch nicht abgebrochen hat. Dies mag Programm sein und von der Autorin gewollt, die ihren Stil gekonnt dem Inhalt anpasst. Doch ist das auch schön? Handelt es sich um Literatur oder um Klamauk? Ist das neu oder abgegriffen? Lesenswert oder lustig? Was Stoff für eine Reihe von Glossen liefert, taugt nicht immer für einen Roman.
Pollatschek verfrachtet uns in den Kopf eines vollverpeilten Vaters, der am Silvestertag allein im vollgemüllten Familienhaus sitzt. Es bleiben nur noch wenige Stunden, bis er seine Frau und die beiden Kinder wiedersehen wird. Der Schriftsteller ohne Werk, der seit Jahren auf dieses hinlebt, macht eine To-do-Liste. Kapitelweise geht er nun das an, was seit langem liegen geblieben war. Dass dieses Unterfangen den von Aufschieberitis Geplagten vor Probleme stellt, überrascht nicht. Ebenso erwartbar sind die Schwierigkeiten, die die einzelnen Erledigungen mit sich bringen.
Aufgabe Nummer eins ist der Aufbau eines Schweden-Möbels. Statt von Ikea spricht Lars von „Korea“ und buchstabiert die Malaise des Zusammenschraubens bis in die fehlenden Einzelteile aus. Das mag manche amüsieren, andere haben das schon oft gelesen und gehört, zu oft. Schrauben und Dübel in „Niezen“, „Pleumel“ oder gar „Henriette Hannelore von Hoffmannsthal“ umzutaufen, macht die Lektüre auch nicht leichter. Ähnlich langweilig gestalten sich die nächsten Listenpunkte. Da wird geputzt, erst im Kopf, dann am Objekt. Es folgt die Steuererklärung, die wie eine Pralinenschachtel ist, „nur ohne Schokolade. Man greift in die Belege und weiß selbst nicht, was man bekommt“.
Würde Lars in seinem lähmenden Denk-Durchfall nicht zu seiner Familie und seinen Gefühlen kommen, was Helden wie Leserin gleichermaßen aktiviert, käme man nie zum Ende. Diese Reflexionen und Phantasien ergießen sich mit den oft redundanten Schilderungen des Prokrastinierens in einen unaufhörlichen Laberflash. Pollatschek gelingt es sehr gut, die innere Welt des Protagonisten abzubilden. Nur stellt sich die Frage, möchte man in diese eintauchen? Lars kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen, vom Dübelchen aufs Püppchen und vom Nüdelchen noch lange nicht zum Nudelsalat. Sehr erwachsen wirkt Lars nicht, auch wenn seine Tochter Lina ihn einen alten, weißen Mann nennt. Sich selbst tituliert er als „Kackvogel“, was ebenso an den Jargon eines Spätpubertierenden erinnert, wie Abtreibung als „wegmachen“ oder Geschlechtsorgane mit „das, da unten“ zu bezeichnen. Das spiegeln auch Wortschöpfungen, wie „Ablarsbrief“, „beckerfäustend“ oder der Satz, „Lina hat sich totgelacht, also nicht wirklich tot, Lina lebt natürlich“.
Auch die Aufgaben bringen nichts Neues. Hat man nicht schon längst alle Witze über Ikea-Möbel und das Scheitern an ihnen gehört? Mich erinnern Lars und seine Probleme an Programme von Comedians, die sich in ihren Unzulänglichkeiten selbstmitleidig suhlen. Oder wie es bei Pollatschek aus dem Mund ihres Protagonisten klingen würde, „walterbenjaminen“. Man nimmt diesem Lars nicht ab, nur eine Zeile dieses Philosophen gelesen zu haben. Genauso wenig, wie Vanderbekes „Muschelessen“ oder Tolstois „Anna Karenina“, die als literarische Verweise zwischen all den Weinerlichkeiten wabern. Vielleicht sind sie eher der nach Lissabon geflohenen Johanna zu verdanken, die ihr „Lars-Männchen“ gerne in folgendes Geplänkel verwickelt: „Johanna sagt dann Ach Walter Benjamine doch nicht wieder so rum, und ich sage ich dachte, du Marxt das?, und manchmal sagt sie dann ich mag dich, mein Engels oder freier, deutscher Lars, bau auf, und manchmal lehnt sie sich an mich, sodass ihre Haare mich ganz leicht am Hals kitzeln, und dann haucht sie J’Adorno.“