Sándor Márai entfacht in „Die Glut“ ein grandioses Drama im Kopf
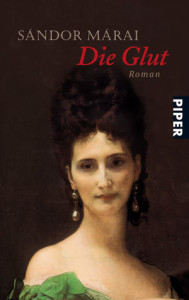 „Ja, du hast wohl viel erlebt. In der Welt draußen. Da vergißt man rasch.“ „Nein“, sagt der andere. „Die Welt ist nichts. Das Wichtige vergißt man nie. Das habe ich erst später gemerkt. Als ich schon um einiges älter war.“
„Ja, du hast wohl viel erlebt. In der Welt draußen. Da vergißt man rasch.“ „Nein“, sagt der andere. „Die Welt ist nichts. Das Wichtige vergißt man nie. Das habe ich erst später gemerkt. Als ich schon um einiges älter war.“
Auch Henrik, der 75jährige Protagonist in Sándor Márais Roman „Die Glut“ kann das einschneidende Ereignis seines Lebens nicht vergessen. Es basiert auf einem Verdacht, für den dem alten General aber jeder Beweis fehlt. Liefern könnte ihn der einzige noch lebende Zeuge, sein Freund Konrád, der sich nach seinem Verschwinden vor 41 Jahren zu einem Besuch ankündigt. In den vergangenen Jahren fügten sich Erinnerungen und Phantasien zu einem Drama in Henriks Kopf, das Márai als psychologisches Kammerspiel inszeniert. 1942 erschien der Roman in Ungarn, wurde 1950 mit dem Titel „Die Kerzen brennen ab“ von Eugen Görcz ins Deutsche übertragen und 1999 in der Neuübersetzung von Christina Viragh vom Piper Verlag wiederentdeckt und berühmt. Ein Jahrzehnt zuvor hatte Sándor Márai den Freitod gewählt. Ein Weltbürger, den es nach Deutschland, Paris, Italien und den USA führte und der doch immer ein Ungar blieb. „Die Glut“ spielt in der Vergangenheit seines Heimatlandes, im österreichisch-ungarischen Glanz der Jahrhundertwende und dem wenig glanzvollen großen Krieg. Doch diese politischen Ereignisse sind Marginalien in einem Werk, in dem ein 75jähriger Mann die Fragen seines Lebens stellt.
Mit diesen konfrontiert er seinem Gast, den gleichaltrigen Konrád. Der hatte die Freundschaft jäh verraten, als er vor 41 Jahren ohne Erklärung die Gegend verließ. Es war im Juli 1899 als das Ungeheure geschah. Die beiden Freunde sind bei der Jagd einem Hirsch auf der Fährte. Als das begehrte Tier auftaucht, spürt Henrik, wie der hinter ihm stehende Konrád mit dem Gewehr auf ihn zielt. Tatsache oder Täuschung? Das Wild springt fort, die Waffe sinkt, die Gefahr ist gebannt. Es herrscht wieder Ruhe. Am Abend erwarten Henrik und seine Frau Krisztina wie immer den Freund zum Diner. Doch das Unausgesprochene lässt Henrik keine Ruhe. Als Konrád an nächsten Tag verschwunden ist und er bei einem Besuch in dessen Wohnung unerwartet auf Krisztina stößt, wächst in Henrik ein ungeheuerlicher Verdacht. Seine Frau und sein bester Freund haben ihn betrogen, planten seinen Tod und eine gemeinsame Flucht. Tief verletzt zieht sich Henrik in das Jagdhaus zurück, während er Krisztina das Schloss überlässt.
Es ist nicht alleine der Betrug, der an Henrik nagt. Verunsichert grübelt er „Warum ist es geschehen? Welche Schuld trage ich daran?“. Die Antworten sucht er in der Erinnerung, in die er eintaucht, wenn die verdrängten Gefühle ihn überfluten. Er denkt an seine erste Begegnung mit Konrád in der k.u.k. Kadettenanstalt, wo sie beide ihre Ausbildung zum Soldat begannen. Ihre Freundschaft erhielt den Segen von Henriks Vaters und wurde so zum heiligen Bund, der die Unterschiede zwischen dem Sohn des wohlhabenden Gardeoffiziers und dem Sproß armer Eltern überwand, und er bleibt bestehen als Henrik beim Militär Karriere macht, während Konrád hinter seiner Uniform ein Künstler bleibt.
Diesem Anderssein begegnete Henrik vor vielen Jahren, als beim Klavierspiel der Freund und seine Mutter einen Zustand erreichten, der den Zuhörern fremd blieb. Konrád sei kein richtiger Soldat, sondern „ein Mensch anderer Art“, lautete die Erkenntnis des Vaters, die einige Jahre später Krisztina fast wörtlich wiederholte. Henrik versteht dies zunächst nicht, doch mit den Jahren sieht auch er „daß es zwischen Männern und Frauen, unter Freunden und Bekannten immer um dieses Anderssein geht, das die Menschen in zwei Parteien aufspaltet“.
Ist also dieses Anderssein der eigentliche Grund für das Scheitern seiner Freundschaft und seiner Ehe? Sind nicht auch seine Eltern an diesem Anderssein gescheitert? Seine Mutter, die feinsinnige Französin, wurde zuerst von einem k.u.k. Offizier in die ungarische Steppe verschleppt und dann von Kaiser Franz Joseph zum Weinen gebracht. In der Folge ließ sich der Vater ein Jagdhaus errichten und überließ seiner Frau und ihrem französischen Chic das Schloss.
Es ist der Handlungsort des Romans. Die Handlungszeit, das Jahr 1940, von dem Henrik auf das Vergangene zurückblickt, macht „Die Glut“ für heutige Leser zur historischen Lektüre. Im Erscheinungsjahr war er ein Roman der Gegenwart.
In seinen Anfangskapiteln führt Marai die Grund-Konstellation ein. Ein einsamer Mann erwartet Besuch, durch den er die Klärung eines zurückliegenden Ereignisses erhofft. In Rückblicken, die zeitweise in einen Monolog an den Zuhörer Konrád und die Leser münden, versucht Henrik die Wahrheit ergründen. Das Vorgehen, Geschehenes nach und nach aus Fragmenten zusammenzusetzen, machen „Die Glut“ zu einem Buch der wiedergefundenen Zeit. So verwundert es nicht, in Márais Roman Proust, den großen Rechercheur der Erinnerung, anzutreffen. Nicht alleine der Lindenblütentee, den die französische Großmutter dem kleinen Henrik beim Besuch in Paris verabreicht, zitiert Prousts Romanwerk, auch im Verhältnis von Henrik und Konrád finden sich Parallelen zu dem von Marcel und St. Loup. Ergänzt wird die Handlung durch atmosphärische Skizzen, in denen Márai das Wien der Jahrhundertwende oder die kolonialen Verhältnisse in Asien beschreibt.
Neben der Musik, die nicht nur in Form von Chopins „Polonaise fantaisie“ den Roman durchzieht, variiert Márai auch das Todes-Motiv. Im Schloss, dem „großen, steinernen Prunkgrab“ zweier an Liebe verstorbenen Frauen, treffen sich zwei alte Männer, um ihre letzten Dinge zu regeln. Die Trauer „von der die Herzen der Menschen krank werden, als wäre das Herzeleid eine Folge der Enttäuschungen der unverständlichen Unglücksfälle des Lebens“ kannte Sándor Márai nur zu gut.