Henry James’ „Daisy Miller“ amüsiert mit Ironie und spritzigen Dialogen
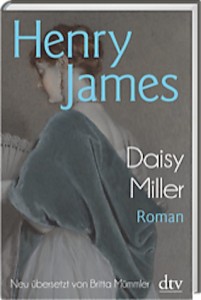 „Ich hab’ keine Zähne, die kaputtgehen können. Die sind alle ausgefallen. Ich hab’ nur noch sieben. Mutter hat sie gestern Abend gezählt, und gleich danach ist noch einer ausgefallen. Sie hat gesagt, sie ohrfeigt mich, wenn noch mehr ausfallen. Dabei kann ich gar nichts dafür. Es liegt alles an diesem alten Europa. Es liegt am Klima hier, dass sie ausfallen. In Amerika ist keiner ausgefallen, es liegt an den Hotels.“
„Ich hab’ keine Zähne, die kaputtgehen können. Die sind alle ausgefallen. Ich hab’ nur noch sieben. Mutter hat sie gestern Abend gezählt, und gleich danach ist noch einer ausgefallen. Sie hat gesagt, sie ohrfeigt mich, wenn noch mehr ausfallen. Dabei kann ich gar nichts dafür. Es liegt alles an diesem alten Europa. Es liegt am Klima hier, dass sie ausfallen. In Amerika ist keiner ausgefallen, es liegt an den Hotels.“
Diese Klage legt Henry James in seiner Novelle Daisy Miller einem neunjährigen Jungen in den zahnlosen Mund und macht so gleich zu Beginn auf sein Thema aufmerksam, die „nationaltypischen“ Unterschiede zwischen Europäern und Amerikanern. Studieren konnte er diese seit früher Jugend. Mit seiner Familie bereiste er den alten Kontinent, der ihm so gut gefiel, daß er später in London, Paris, Bologna, Bonn und Genf studierte, sich dann in England ansiedelte und schließlich die Staatsbürgerschaft seiner Wahlheimat annahm. Dies geschah kurz vor seinem Tod, der sich in diesem Jahr am 28. Februar zum hundertsten Male jährte.
Ob aus dem kleinen Randolph auch einst ein Europäer werden wird, bleibt der Phantasie überlassen. Leider, dem ironischen Plauderton James” hätte ich gerne noch länger gelauscht, doch nach gut hundert Seiten ist Schluss. In diesen führt James den Leser zunächst an den Genfer See. Dort liegt Vevey, im Sommer 1878, dem Erscheinungsjahr der Novelle, the place to be nicht nur für reiche Amerikaner. Im luxuriösen „Trois Couronnes“, genauer an der davor gelegenen Uferpromenade, treffen der 27-jährige Winterbourne und Daisy Miller, die ältere Schwester Randolphs, aufeinander. Während Winterbourne während seiner Jahre in Genf die dort herrschende Zurückhaltung angenommen hat, agiert die junge und attraktive Amerikanerin nach puritanischen Maßstäben eher am Rande der Regeln. Die Tochter eines wohlhabenden Industriellen aus der amerikanischen Provinz verblüfft Winterbourne durch ihr selbstsicheres Auftreten. Ihr fabelhaftes Aussehen hatte bereits etliche Gentlemen auf New Yorker Dinnerpartys beeindruckt. All’ dies erzählt sie freimütig Winterbourne, den die naive, gern flirtende Amerikanerin zunehmend fasziniert. Sie habe keine „Vorstellung von Form“, weil sie aus der Provinz komme und keine Bildung besitze, verteidigt Winterbourne sie gegenüber seiner Tante. Diese hat die Millers bereits als die „Sorte Amerikaner“ identifiziert, „die zu ignorieren geradezu eine Pflicht ist“. Doch da ist Winterbourne bereits der unkonventionellen Daisy erlegen. Immerhin ist sie nicht ganz so frech wie ihr kleiner Bruder, der Promenadenschreck, und nicht ganz so töricht wie ihre Mutter, der die beiden Kindern auf dem Kopf herum tanzen. Man ahnt, daß Mr Miller die Europareise sehr freiwillig finanziert hat.
Mrs Miller hat gegen die neue Bekanntschaft ihrer Tochter mit dem Gentleman kaum Einwände, dessen Tante, Mrs Melrose, sehr wohl. Sie rät ihrem Neffen dringend davon ab und findet den geplanten Ausflug ungebührlich. Doch die beiden jungen Leute unternehmen die Fahrt zum Château de Chillon gemeinsam und alleine. Wer weiß, was noch geschehen wäre, wäre Winterbourne nicht kurz darauf wieder nach Genf gereist. Zum Abschied vereinbaren sie ein Treffen in Rom, wo die Millers die Wintermonate verbringen und Winterbourne im Januar seine Tante besuchen wird.
Von diesem Wiedersehen erzählt die zweite Hälfte der Novelle. Den zwei Kapiteln in Vevey, wo ein in Genf gezähmter Gentleman seine Chance nicht ergreift, folgen zwei Kapitel in Rom, die ihm zeigen, daß dies nicht ohne Folgen bleibt. Denn dort wird Daisy schon längst von Mr Giovanelli begleitet, der ihr an Attraktivität und Flirtlust in nichts nachsteht. Sie genießt die großartige Gesellschaft Roms, die sie jedoch jenseits der Gäste findet, die Mrs Walker in der Via Gregoriana zum Tee empfängt. Daisy bevorzugt die italienischen Gentlemen. Besonders Mr Giovanelli sei inzwischen „ein richtig guter Freund“ und „der schönste Mann der Welt, natürlich abgesehen von Mr Winterbourne“, neckt sie diesen und setzt die Qual fort, indem sie verlangt von ihm zum Pincio begleitet zu werden. Dort will sie den schönen Signore treffen. Ihr Verhalten provoziert den verliebten jungen Mann und noch mehr seine Landsleute in Rom. Trotz aller Ratschläge rennen die beide jungen Amerikaner ins Verderben. Daisy wird sogar doppelt bestraft, wie man in Genf glauben würde.
Henry James ist ein Meister des Dialogs. Seine Figuren brillieren im ironischen Schlagabtausch, der die Handlung vorantreibt. Ebenso meisterhaft führt er in die Novelle ein. Er beginnt konventionell mit einer Beschreibung des Handlungsorts Vevey und dem Auftritt seiner Hauptpersonen. Doch liegen darin bereits seine Hauptmotive. Nicht nur die am Ufer des Genfer-Sees gelegenen Hotels sind gediegen, bescheiden oder auffallend wie Emporkömmlinge. Ähnliche Abstufungen zeigen auch Rang und Ruf ihrer Bewohner. Die feinen Unterschiede der Gesellschaft, ob man dazu zählt und wie man sich in ihr bewegt, führt James in seiner Liebesgeschichte vor. Sein Winterbourne ist in den 20 Jahren im calvinistischen Genf fast schon zum Europäer geworden, während Daisy Miller als unbefangene Neureiche aus der amerikanischen Provinz auftritt. Sie setzt die Benimmregeln außer Kraft, die für die wohlanständigen amerikanischen Kreise gelten, für die Mrs Melrose, Winterbournes Tante, sprechen und später in Rom auch Mrs Walker.
Es ist ein präziser Blick, mit dem Henry James seine Figuren beschreibt und ihre Schwächen entlarvt, sie aber nie bloßstellt. Nicht nur die Unterschiede zwischen der amerikanischen Gesellschaft und der in good old Europe befeuern seine Ironie, auch die Konventionen, denen Männer und Frauen in unterschiedlichem Maß unterworfen sind, „ein Mann darf kennen, wen er will“. Sein Erzähler kommentiert, mitunter auch in direkter Leseransprache, das Befinden seiner Figuren, während diese die Scheinheiligkeit der Sittsamen entlarven.
„(…) hören Sie doch wenigstens auf, mit Ihrem Freund am Klavier zu flirten. Die Leute hier“, versicherte er ihr, als ob er ganz aufseiten der „Leute hier“ stünde, „verstehen so etwas nicht.“
„Und ich dachte, die Leute hier verstehen nichts anderes als das!“, rief Daisy mit erstaunlicher Welterfahrung.
„Nicht bei jungen, unverheirateten Frauen.“
„Mir kommt es bei jungen, unverheirateten Frauen sehr viel anständiger vor als bei den alten verheirateten“, erwiderte sie.“
Ob nun das Forsche oder das Zögerliche dem Glück im Wege stand oder einfach nur der in der guten Schweizer Luft Akklimatisierte nicht gegen den „von heimtückischen Dünsten“ erfüllten „Hauch vergangener Zeiten“ Roms anstinken konnte, das entscheide nach der Lektüre ein jeder selbst. Henry James” kurzweilige Skizze der Gesellschaft gegen Ende des 19. Jahrhunderts liegt bei dtv in der kommentierten Neuübersetzung von Britta Mümmler vor.
Henry James, Daisy Miller, übers. v. Britta Mümmler, 1. Aufl. 2015, dtv