Sándor Márai entfacht in „Die Glut“ ein grandioses Drama im Kopf
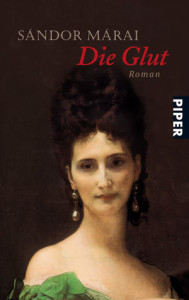 „Ja, du hast wohl viel erlebt. In der Welt draußen. Da vergißt man rasch.“ „Nein“, sagt der andere. „Die Welt ist nichts. Das Wichtige vergißt man nie. Das habe ich erst später gemerkt. Als ich schon um einiges älter war.“
„Ja, du hast wohl viel erlebt. In der Welt draußen. Da vergißt man rasch.“ „Nein“, sagt der andere. „Die Welt ist nichts. Das Wichtige vergißt man nie. Das habe ich erst später gemerkt. Als ich schon um einiges älter war.“
Auch Henrik, der 75jährige Protagonist in Sándor Márais Roman „Die Glut“ kann das einschneidende Ereignis seines Lebens nicht vergessen. Es basiert auf einem Verdacht, für den dem alten General aber jeder Beweis fehlt. Liefern könnte ihn der einzige noch lebende Zeuge, sein Freund Konrád, der sich nach seinem Verschwinden vor 41 Jahren zu einem Besuch ankündigt. In den vergangenen Jahren fügten sich Erinnerungen und Phantasien zu einem Drama in Henriks Kopf, das Márai als psychologisches Kammerspiel inszeniert. 1942 erschien der Roman in Ungarn, wurde 1950 mit dem Titel „Die Kerzen brennen ab“ von Eugen Görcz ins Deutsche übertragen und 1999 in der Neuübersetzung von Christina Viragh vom Piper Verlag wiederentdeckt und berühmt. Ein Jahrzehnt zuvor hatte Sándor Márai den Freitod gewählt. Ein Weltbürger, den es nach Deutschland, Paris, Italien und den USA führte und der doch immer ein Ungar blieb. „Die Glut“ spielt in der Vergangenheit seines Heimatlandes, im österreichisch-ungarischen Glanz der Jahrhundertwende und dem wenig glanzvollen großen Krieg. Doch diese politischen Ereignisse sind Marginalien in einem Werk, in dem ein 75jähriger Mann die Fragen seines Lebens stellt.
Mit diesen konfrontiert er seinem Gast, den gleichaltrigen Konrád. Der hatte die Freundschaft jäh verraten, als er vor 41 Jahren ohne Erklärung die Gegend verließ. Es war im Juli 1899 als das Ungeheure „„Die Wirklichkeit ist nicht die Wahrheit““ weiterlesen