Barbara Kingsolver erzählt in Die Giftholzbibel vom Clash of Cultures
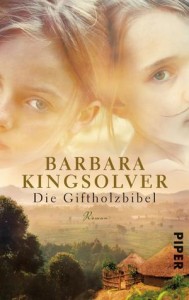 Das Cover ist von der Art, daß man das Buch, hätte man es unbedacht zur Hand genommen wie ein Blatt der titelgebenden Giftholzpflanze mit Furcht fallen ließe. In apricotfarbenes Licht getaucht, bietet sich dem Betrachter ein Blick auf Wälder und Wiesen einer Flussebene. Eine Bergkette begrenzt den Horizont, während im Vordergrund zwei Lehmhütten mit Strohdach und grünumrankten Zaun ein afrikanisches Idyll mit Aussicht evozieren. Darüber erheben sich die Gesichter zweier Mädchen, die engelsgleich und blondgelockt ihrem Schicksal entgegen harren. In einer Buchhandlung hätte ich diesem Roman keinen weiteren Blick gegönnt und ihm damit bitter Unrecht getan. Zum Glück wurde er mir von einer begeisterten Leserin empfohlen, die mein Interesse an der kolonialen Geschichte Afrikas kennt.
Das Cover ist von der Art, daß man das Buch, hätte man es unbedacht zur Hand genommen wie ein Blatt der titelgebenden Giftholzpflanze mit Furcht fallen ließe. In apricotfarbenes Licht getaucht, bietet sich dem Betrachter ein Blick auf Wälder und Wiesen einer Flussebene. Eine Bergkette begrenzt den Horizont, während im Vordergrund zwei Lehmhütten mit Strohdach und grünumrankten Zaun ein afrikanisches Idyll mit Aussicht evozieren. Darüber erheben sich die Gesichter zweier Mädchen, die engelsgleich und blondgelockt ihrem Schicksal entgegen harren. In einer Buchhandlung hätte ich diesem Roman keinen weiteren Blick gegönnt und ihm damit bitter Unrecht getan. Zum Glück wurde er mir von einer begeisterten Leserin empfohlen, die mein Interesse an der kolonialen Geschichte Afrikas kennt.
„Richtig. Trinken wir auf die Bibel“, sagte Leah und stieß mit ihrer Bierflasche an meine an.
„Tata Jesus ist bängala!“ sagte Adah und hob ebenfalls ihre Flasche. Sie und Leah sahen einander eine Sekunde lang an , dann brachen sie in hyäneneartiges Geheul aus.
„Jesus ist Giftholz!“ sagte Leah. „Ich trinke auf den Prediger des Giftholzes. Und auf seine fünf Frauen!“
„Den Indern ein Inder sein“ war das Motto des Missionars Ferdinand Kittel, der die Evangelisierung nicht als Kampf gegen das Reich des Teufels ansah, sondern den christlichen Glauben behutsam in das Leben der indigenen Bevölkerung einbringen wollte. Die respektvolle Auseinandersetzung mit der Kultur und den Menschen des Missionsgebietes hielt er für eine notwendige Voraussetzung. Ein Missionar sollte nicht nur theologisch gerüstet, sondern vor allem didaktisch und praktisch auf seine Aufgaben vorbereitet sein, wozu nicht zuletzt Sprachkenntnisse zählen.
Kaum eine dieser Voraussetzungen erfüllt Nathan Price, der Missionar in Barbara Kingsolvers Roman „Die Giftholzbibel“, und so wundert es kaum, daß er falsch macht, was er nur falsch machen kann. Es ist das Jahr 1959 als der Prediger aus der kleinen Baptistengemeinde Bethlehem in Georgia mit Frau und vier Töchtern in Belgisch-Kongo landet. Einen denkbar schlechten Zeitpunkt hat er gewählt, denn das Land steht in der Folge der afrikanischen Dekolonisation vor dem Umbruch. Die Missionsstation Kilanga inmitten des Dschungels befindet sich ebenfalls in Auflösung. Einst wurde sie von vier Familien und einem Arzt betreut, doch in den letzten sechs Jahren lebte hier nur Bruder Fowles. Der alleinstehende Missionar hat sich jedoch mit einer Kongolesin ins wahre Leben aufgemacht. Im einzigen Steingebäude zwischen den Holzhäusern der Dorfbevölkerung wartete nun der Papagei Methusalem auf die Rückkehr christlicher Wohltäter.
Wie sich diese gestaltet lässt Kingsolver von den Frauen der Familie Price erzählen. Mutter Orleanna blickt zu Beginn eines jeden der sieben Romanteile auf das Geschehen zurück, welches nachfolgend ihre vier Töchter kommentieren. Es sind die sechszehnjährige Rachel, die fünfjährige Ruth May und die vierzehnjährigen Zwillinge Leah und Adah, die jede auf ihre eigene Weise das Wort ergreifen.
Die im Titel zitierte Bibel prägt auch die Struktur des Romans. Seine Teilkapitel sind nach bekannten Bibelabschnitten wie Genesis und Exodus benannt, und werden durch entsprechende Verse eingeleitet. Die vier Mädchen beschreiben wie die vier Evangelisten das Geschehen. In unterschiedlicher Sicht geben sie ihre Erlebnisse wieder, als widerspenstiger Teenager, als unschuldiges Kind. Besonders interessant sind die vierzehnjährigen Schwestern Leah und Adah, die in ihrer ausserordentlichen Begabung die neuen Erfahrungen als Bereicherungen erleben.
Durch sie erfährt der Leser von dem überzogenen Sendungsbewusstsein des Vaters. Er scheitert er bereits an der Sprache, da er weder die Verkehrssprache französisch geschweige denn Kikongo beherrscht. Ebenso wenig kümmert er sich um die medizinische oder soziale Versorgung des Dorfes. Durch seine Unkenntnis von Klima wie Kultur wird er den Bewohnern zur Last. Gäbe es nicht den mehrsprachigen Lehrer Anatol, könnte der Reverend nicht einmal predigen. Während er sich um die seelische Rettung seiner Schäfchen sorgt, die er nichts ahnend vom Appetit der Krokodile am liebsten im Fluss taufen würde, kämpft seine Familie ums Überleben. Im Gepäck befinden sich zwar Malariatabletten in ausreichender Zahl, die übrigen Vorräte erweisen sich jedoch als ungeeignet. Orleanna und ihre Töchter müssen lernen wie sie mit dem ungewohnten Nahrungsangebot zurecht kommen und auch mit der ungewohnten Sprache. Ruth May, der Jüngsten gelingt diese Hürde spielerisch, die anderen folgen nach.
Nur der Reverend sperrt sich, als Despot mit Gottes Segen gebärdet er sich autoritär. Sein Verhalten, unter dem Frau und Töchter schon in der Heimat litten, führt in Kilanga ins Leere. Der Missionar kämpft aussichtslos gegen das vermeintliche Reich des Teufels, das sich im feuchtwarmen Klima, in Malaria und Durchfall, in giftigen Pflanzen und Tieren manifestiert. Den Zugang, den er sich verbaut, finden seine Töchter mit Offenheit und Wissbegier.
Kingsolver schildert in ihrem stellenweise psychologischen Roman feinfühlig die Konflikte und Traumatisierungen, denen die Personen ausgesetzt sind. Dadurch erzeugt sie auch Verständnis für die innere Verfassung des Missionars. Ebenso erzählt sie vom schwierigen Leben in der kongolesischen Natur. In dramatischen Szenen schildert sie eine Invasion der Wanderameisen und die daraus folgende Treibjagd.
In der Romanhandlung findet auch das Zeitgeschehen seinen Platz. Die Umbrüche, die die neue Unabhängigkeit hervorrufen, machen sich auch in Kilanga bemerkbar. Da die Bewohner „erst kürzlich den Dreh des demokratischen Prozesses heraus gekriegt“ haben, fordern sie eine Abstimmung über „Jesus Christus im Amt des persönlichen Gottes von Kilanga“. Für das Kieselsteinvotum stehen zwei Schalen bereit, die christliche kennzeichnet ein Kreuz als Symbol, die profane eine Flasche Palmwein.
Doch sobald Kingsolver über das blutige Chaos der Aufstände und über den Mord an Patrice Lumumba berichtet, wirkt dies sehr referierend und erzeugt Längen. Im Wunsch ein Epos zu füllen erzählt sie da weiter, wo sie meiner Meinung nach besser geendet hätte. Die Eskalation, in der für Familie Price der Aufenthalt in Kilanga endet, hätte nach gut 400 Seiten auch ein grandioses Ende für den Roman ergeben. Warum die Schicksale der Töchter über weitere Jahrzehnte verfolgt werden müssen, erschließt sich mir nicht. Vor allem die Veränderung der Figur Rachel, die in Kilanga den Clash of Cultures als einzige luzide und in sarkastischem Ton kommentiert, finde ich schade.
Der letzte Teil des Romans, der in typisch apricotfarbener Manier, ‑einzig hier behält das Cover Recht- , die Sympathieträger dem Happyend zuführt, zeigt wenigstens wie der Reverend seine Aufgabe besser hätte verfolgen können, indem er, wie seine Tochter Leah, den Afrikanern ein Afrikaner geworden wäre.
Nichtsdestotrotz ist „Die Giftholzbibel“ ein spannender und anspruchsreicher Roman über das Aufeinanderprallen von Kulturen. Seine Autorin, Barbara Kingsolver, entwickelte ihn nicht aus aktuellen Recherchen vor Ort, wie sie in ihrem Nachwort berichtet, sondern aus Erinnerungen an einen einjährigen Kongoaufenthalt als Kind. Ergänzt hat sie diese durch Lektüren in Literatur und Fachbüchern, die sie im Anhang anführt. Eine kleine Afrikakarte ergänzt die Ausgabe. Der Neuauflage wünsche ich dringend eine Gestaltung, die den Roman aus der Schublade der Schicksalsdramen herausholt.
Barbara Kingsolver, Die Giftholzbibel, übers. v. Anne Ruth Frank-Strauss, Piper Verlag 2012
Liebe Kerstin,
herzlichen Dank für diese interessante Besprechung. Das Buch hatte ich schon länger auf dem Radar, aber jetzt weiß ich, dass ich es haben muss…
LG
Tom
Hallo Tom, es ist wirklich ein bemerkenswertes Buch, in dem es viel zu entdecken gibt, was ich hier nicht explizit erwähnt habe. Darunter auch die Darstellung der indigenen Bevölkerung, die weder abwertend noch idealisierend erfolgt. Den edlen Wilden gibt es hier ‑na ja, fast- nicht. Ebenso interessant ist der Bibelbezug, entsprechend Belesene dürften einiges entdecken.
Vielleicht ergibt sich ja nach Deiner Lektüre eine Diskussion auf der Leselust?
Wenn Du den Roman antiquarisch suchst, er wurde auch unter dem Titel „Willkommen in Kilanga” verlegt.