Pierre Bayard verteidigt den fernen Blick
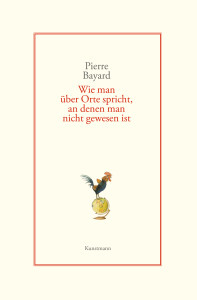 „Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat“, dieses Essay des Literaturwissenschaftlers und Psychoanalytikers Pierre Bayard hat mich vor kurzem sehr beeindruckt. Begeistert von seinen Theorien zum Lesen erwartete ich neue geistreiche Ausführungen zum Thema „Wie man über Orte spricht, an denen man nicht gewesen ist“.
„Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat“, dieses Essay des Literaturwissenschaftlers und Psychoanalytikers Pierre Bayard hat mich vor kurzem sehr beeindruckt. Begeistert von seinen Theorien zum Lesen erwartete ich neue geistreiche Ausführungen zum Thema „Wie man über Orte spricht, an denen man nicht gewesen ist“.
Nicht nur äußerlich gleicht das im Kunstmann-Verlag erschienene neue Buch seinem Vorgänger. Das schlichte beige Cover ziert ein gallischer Hahn, der diesmal nicht auf einem Stapel Bücher sondern auf einem Globus Position bezogen hat. Auch der Aufbau des Essays wurde übernommen. Von Arten des Nichtlesen über Gesprächssituationen bis zu Empfohlenen Haltungen äußert sich Bayard zu Orten, die man nicht kennt (UB), die man überflogen hat (ÜO), die man vom Hörensagen kennt (EO) und die man vergessen hat (VO). Daraus ergeben sich entsprechende Kategorien, die man ähnlich aus dem Vorgängerbuch kennt. Die Folgekapitel tragen den gleichen Titel wie im ersten Essay, teilen sich aber dem Sujet entsprechend in verschiedene Unterpunkte. Die Wahl der Gesprächssituationen unterscheidet sich allerdings, der Autor wählt zum Thema Reisen Szenarien aus der Anthropologie, dem Journalismus, Sport und Familie. Dem Nichtreisenden empfiehlt er im letzten Kapitel folgende Haltungen, Grenzen öffnen, in der Zeit zirkulieren, durch den Spiegel gehen und sich lieben.
Bayard betont im Vorwort, daß die Parallelität zwischen seinen beiden Essays beabsichtigt sei. Er möchte zeigen, daß „unsere partielle oder auch vollständige Unwissenheit über einen Gegenstand nicht unbedingt ein Handicap sein muss, um sachkundig über ihn zu reden, (…).“ (S. 16) Gespannt begann ich die Lektüre. Auch wenn ich viel Wohlbekanntem begegnete, überraschte mich die Richtung.
Marco Polos Reisebericht aus China bildet den Einstieg in dieses Reisehandbuch für Nichtreisende. Ob der Venezianer tatsächlich das ferne Land durchquerte, wird in der historischen Forschung kontrovers diskutiert. Bayard vermutet, daß Marco Polo seine Chinaphantasien einer Schönen ins Ohr flüsterte ohne sich jemals von seiner Heimatstadt weg bewegt zu haben.
Die anschließende Betrachtung analysiert die Reisegewohnheiten des Phileas Fogg. Es erstaunt kaum, daß diese Figur Jules Vernes als Exempel des Reisenden dient, der Orte lediglich überfliegt. Fogg, dessen Ziel eine Weltumrundung mit festem Zeitlimit ist, sei nicht auf Ortsbegehungen aus. Dieser Reisende „dreht sich vielmehr wie ein seelenloser Gegenstand um die Erde.“ (S. 39) Der Autor zieht hier die Parallele zum Querlesen von Büchern. Doch ist dieser Vergleich angemessen? Wäre Foggs Wette nicht eher mit einer Ankündigung vergleichbar, ein Buch in einer vorher festgelegten Zeit zu durchblättern? Beim Querlesen wird noch gelesen aber lässt sich ein Schnelltransport um die Erde noch als Reise bezeichnen?
Was macht eine Reise aus? Der Autor definiert seinen Untersuchungsgegenstand nicht. Darin liegt meines Erachtens das Grundproblem des Essays. Bayard entwickelt vielmehr anhand fast ausschließlich literarischer Beispiele eine diffuse Theorie des Überblicks. So gelinge ein Überblick über einen Ort nur ohne sich „auf irgendein zweitrangiges Detail zu fokussieren“ (S. 47), dies sei bei hoher Reisegeschwindigkeit gegeben und schütze vor Stereotypen und Verallgemeinerungen. Wirklich?
Wer hat nicht schon von den berühmten Lehnstuhlreisenden der Vergangenheit gehört? Bayard führt einen modernen Vertreter an, Édouard Glissant, dem Alter und Krankheit verwehrten sein Traumziel zu bereisen und der darum seine jüngere Frau zu den Osterinseln schickte. Sie recherchierte vor Ort, Glissart schrieb zu Hause das Reisebuch. Diese merkwürdige Aufgabenteilung, sie Körper, er Kopf, besitzt, so Bayard „zahlreiche Vorteile, darunter jenen, dass sämtliche körperlichen Gefahren auf eine Person versammelt werden, während sich die zweite Hälfte des Paares auf das Wesentliche konzentrieren kann: eine genaue Erfassung des Ortes und seine Rekonstruktion durch das Schreiben.“ (S. 55)
Die vielfältigen Umformungen, welche das Erleben einer Person durch Erinnerungsvorgänge und Erzählen permanent verändert, scheinen dem Autor und Psychologen fern. Oder doch nicht? Denn im nächsten Kapitel berücksichtigt er, daß Orte verwechselt und vergessen werden. Sein unzuverlässiger Zeuge ist Chateaubriand, der viele der vergessenen Orte nur durch Reiseberichte und literarischen Texten kennt, die er in seine Betrachtungen der unbesuchten Orte verwebt.
Nach diesem ersten Kapitel ist klar, daß Bayard vorwiegend das literarische Reisen betrachtet, er geht nicht von der praktischen Situation aus, versucht aber für diese Ratschläge von den bisher vorgestellten Nichtreisenden abzuleiten.
Im Kapitel Gesprächssituationen setzt er dieses Vorhaben allerdings nicht um, wie im Bücheressay, sondern führt die Reihe seiner Reiseentsager fort. Auch hier hört der erfahrene Leser bekannte Geschichten, wie die von Margaret Meads Samoa-Studie. Obwohl gerade diese ein gutes Beispiel dafür ist, weshalb Ethnologen eine sensible teilnehmende Beobachtung als Grundlage ihrer Beschreibungen durchführen sollten, argumentiert Bayard vehement gegen diese Methode der Feldforschung. Sie mag bisweilen zu Einflüssen oder gar Pannen führen, die das Ergebnis verfälschen, aber ihr die Imaginationen und Phantasien eines Abwesenden vorzuziehen ist absurd.
Mit Augenzwinkern philosophiert Bayard über das Phänomen des Nichtreisens, sein Buch „versteht sich als eine Verteidigung der (…) distanzierten Beobachtung“. (S. 100) Wissenschaftlich ist dies nicht, aber es amüsiert, wenn er von dem amerikanischen Journalisten Jason Blair berichtet, der eines Tages vollkommen darauf verzichtet seine Wohnung zu verlassen und seine Artikel aus fremden Quellen speist. Ebenso wie Rosie Riuz, die 1980 den Boston Marathon mit einer pfiffigen Eulenspiegelei gewann. Die anschließende Überlegung, daß auch Philippides, der erste Marathon-Läufer, gerne die Bequemlichkeit eines öffentlichen Verkehrsmittels der elenden Rennerei vorgezogen hätte, kommt gleichfalls aus der Argumentationskiste eines Eulenspiegels.
Einem Baron von Münchhausen hingegen gleicht der Zeuge, mit dem Bayard uns die erste seiner empfohlenen Haltungen nahebringen will. Georg Psalmanazar erfreute zu Beginn des 18. Jahrhunderts ganz London mit den Berichten über seine Heimat Formosa. Ob man in diesen Zusammenhängen den Begriff des von Freud geprägten inneren Raumes anführen muss oder den atopischen Raum als Locus sine qua non idealisieren sollte, sei bezweifelt.
Auch Karl May halte ich nicht für ein gut gewähltes Beispiel eines erfolgreichen Nichtreisenden. Die von Bayard angeführte fortschrittliche Kritik am Umgang mit der indigenen Bevölkerung hat May eben nicht intuitiv aus der Distanz erspürt, sondern wie seine präzisen Landschaftsbilder schlicht und einfach abgeschrieben. Die Leserin begegnet mit Blaise Cendar und Nina Berberova weiteren Imaginationsreisenden und verzweifelt an Sätzen wie: „Der Geist des Ortes, der in der Sprache angesiedelt ist, ist untrennbar von der Kommunikation mit dem anderen und hängt nicht einzig vom imaginären Land des Autors ab.“ (S. 185)
Das Essay schließt mit einem Glossar, dessen Stichworte folgendes Resümee ergeben:
Bayards atopische Kritik zum atopischen Raum setzt auf die distanzierte Beobachtung um den Geist des Ortes zu erfassen. Ein imaginäres Land ermöglicht uns durch Informanten unser inneres Land und dessen literarische Wahrheit aufzuspüren ohne jede physische Präsenz. Der plurale Singular der psychischen Präsenz ermöglicht dem sesshaften Reisenden ohne Reise in ein reales Land und ohne teilnehmende Beobachtung einen Überblick sowie universelle Erfahrung. Nur die Unreise garantiert die Rückkehr in das ursprüngliche Land der ersten Kindheitsträume.
Ein anregendes Gedankenspiel bieten Bayards Ausführungen trotz allem. Leider fehlt im Buch die Literaturliste. Wer sich mit seinen Quellen auseinander setzten möchte, findet sie im folgenden ergänzt mit weiteren Angaben.
Nina Berberova, Das schwarze Übel. Berlin 2003.
Jason Blair, Burning down my Master’S House. Beverly Hills 2004.
Emmanuel Carrèrre, Amok. Frankfurt 2003.
François René de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jerusalem, Paris 2005.
id., Mémoires d’outre-tombe I. Paris 2009.
id., Ètudes historique et Voyage en Amerique, Paris 1860.
zu Chateaubriand: Michel de Jaegher, Le Menteur magnifique. Paris 2006.
Blaise Cendrars, Auf allen Meeren.. Basel 2008
zu Cendrars: Miriam Cendrars, Blaise Cendrars: Eine Biographie. Basel 1986.
Édouard Glissant, Das magnetische Land: Die Irrfahrt der Osterinsel Rapa Nui. In Zusammenarbeit mit Sylvie Séma. Heidelberg 2010.
Karl May, Winnetou 1. Reiseerzählung. Bamberg 1951.
zu May: Karl Markus Kreis, Rothäute, Schwarzröcke und Heilige Frauen. Deutsche berichten aus der Indianer Mission in South Dakota. Bochum 2000.
Margaret Mead, Jugend und Sexualität in primitiven Gesellschaften, I. Kindheit und Jugend in Samoa.. München 1970.
zu Mead: Derek Freeman, Liebe ohne Aggression. Margaret Meads Legende von der Friedfertigkeit der Naturvölker. München 1983.
George Psalmanazar, Memoires of ****. Commonly konown by the name of Geroge Psalmanazar; a reputed native of Formosa. Written by himself in order tob e published after his death, London 2011.
zu Psalmanazar: Richard M. Swiderski, The False Formosan: Georg Psalmanazar and the Eighteenth-Century Experiment of Identity. San Francisco 1991.
Marco Polo, Die Wunder der Welt: Il Milione: Die Reise nach China an den Hof des Kublai Khan. Frankfurt 2003
zu Polo: Frances Wood, Marco Polo kam nicht bis China. München 1996.
Jules Verne, In 80 Tagen um die Welt. München 2011.
Auf diese Besprechung bin ich ganz besonders neugierig gewesen — und nun ein wenig enttäuscht (nicht von der Besprechung, sondern vom Objekt des Besprechens). Ich hatte erwartet, dass Bayard, ähnlich wie beim Lesen auch, über das wirkliche Reisen schreibt, wobei die literarische Reise ja durchaus EINE Art des Reisens hätte sein können, aber eben nur eine. Wenn ich den Bayard nun doch lese, habe ich aber auf jeden Fall schon einmal keine falschen Vorstellungen davon, sondern weiß, worauf ich mich einlasse.
Viele Grüße, Claudia
Eine schöne Lektüre sind die Reisebetrachtungen auf jeden Fall. Wem das Thema der Lehnstuhlreisenden nicht so bekannt ist und wer nicht so pingelig ist, wird gut unterhalten.
Ich hab es inzwischen auch gelesen und habe dem im Grunde nichts hinzuzufügen. Das Kapitel über Karl May hat mir gut gefallen, von Georg Psalmanazar hatte ich noch nie gehört.