Zu wenig Zeit für dieses?
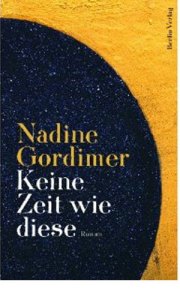 Der neue Roman der 89-jährigen Nobelpreisträgerin Nadine Gordimer spielt wie alle ihre Romane in Südafrika. Dieser Staat, die Heimat dieser sich selbst als weiße Südafrikanerin empfindenden Autorin, ist auch die Hauptfigur in „Keine Zeit wie diese
Der neue Roman der 89-jährigen Nobelpreisträgerin Nadine Gordimer spielt wie alle ihre Romane in Südafrika. Dieser Staat, die Heimat dieser sich selbst als weiße Südafrikanerin empfindenden Autorin, ist auch die Hauptfigur in „Keine Zeit wie diese“. Als weitere tritt ein Ehepaar auf, der Weiße Steve und die Schwarze Jabulile. Dieses Mischung und ihre Zughörigkeit zum Antiapartheidskampf machte sie zu einem klandestinen Paar, zunächst lebten sie als Genossen in Swasiland, dann illegal in einer Siedlung am Rand einer Stadt ihres Heimatstaates. Hier setzt die Erzählung ein und schildert, wie die Beiden diese Wohnlage zu Gunsten eines kleinen Häuschens in der Vorstadt aufgeben. Dort leben sie in der alternativen Gemeinschaft der Ex-Genossen, eher als Bohème denn als Bourgeois. Doch dies ändert sich, Kinder werden geboren, Karrieren verfolgt. Die Lebensumstände und Beziehungen verändern sich genau so wie die politischen Zustände sich verschlechtern. Es offenbart sich, daß die Ziele des Kampfes nicht erreicht wurden. Entgegen aller Ideale hat sich eine neue Ungerechtigkeit entwickelt, die nicht auf unterschiedlicher Hautfarbe basiert, sondern auf der Kluft zwischen arm und reich, gefördert und nicht verhindert von korrupten Politikern. Gordimer wirft über eine Spanne von 16 Jahren Schlaglichter auf die Entwicklungen von Ehe, Familie und dem Freundeskreis der Genossen, für diese gilt ebenso wie für die Politik Südafrikas, „Nichts ist wie es scheint“.
Eine harte Kritik an der südafrikanischen Regierung, die Gordimer neben der bürgerlichen Intelligenz für die katastrophalen Zustände ihres Landes verantwortlich macht, ist der Antrieb für diesen Roman. Sein Ziel ist es diese Mißstände bewusst zu machen. Dies ist Gordimer gelungen, doch auf eine anstrengende Weise. Stil und Sprache erschweren den Zugang. Satzteilketten, nicht immer logisch aufeinanderfolgend, doch mit zahllosen Kommata voneinander getrennt, sind mal Gedanken, mal Gerede, nicht immer eindeutig zu zuordnen. Manche Übersetzungs- oder Sinnfehler kommen dazu. Das mag man hinnehmen. Vielleicht gebietet es auch die Ehrfurcht vor einer altehrwürdigen Nobelpreisträgerin, ihr den Wunsch nach keinem Lektor zu gewähren. Das Verständnis der Leser verwirrt es eher.
Nach einer Weile, bei mir hat es ungefähr die Hälfte der immerhin 506 Seiten gedauert, liest man sich ein und wundert sich nicht mehr über Sätze, wie „In der Partnerschaft der Ideale Liebe, sexuelle Erfüllung und Zukunftspfand Kinder, die das Mysterium namens Ehe ist, ist die Bildung Steves Abteilung. Felsen ist unter ihren Füßen, unter der unterschiedlichen Arbeit, die jeder tut; ihre gemeinsamen Überzeugungen.”
Viel stärker hat mich der deutlich erhobene Zeigefinger gestört. Wenn man nach einer Weile mit den südafrikanischen Zuständen und Gordimers Kritik daran vertraut ist, und sie sich durch eigene Recherchen erschlossen hat, ‑hier wäre ein Glossar dem weniger kundigen Leser hilfreich‑, fällt die Absicht der Autorin ins Auge. Die eigentliche Handlung mit ihren Personen dient als Exempel um Gordimers politische Meinung zu transportieren. Dass diese durchaus berechtigt ist, möchte ich ihr als ehemaligem Mitglied des ANC keinesfalls in Abrede stellen. Allerdings ist sie durchschaubar und macht die Entwicklungen im Roman vorhersehbar.
Ein weiteres Manko ist die ungeheure Redundanz. Wenn der auswanderungswillige Steve sich Informationsmaterial über Australien durchliest, ist es ermüdend die gleichen Fakten mehrere hundert Seiten später nochmals von Jabu repetieren zu lassen. Dies nur ein Beispiel unter vielen, die mich positiv daran erinnerten, daß ich noch nicht vergesslich bin. In einem Roman ärgert mich das jedoch sehr, denn immerhin hätte er mir nach Kürzung dieser Wiederholungen weniger Lesezeit gestohlen.
Vielmehr hätte ich weniger Lesezeit schenken müssen, dem Roman und dem Berlin Verlag. Dieser hatte anlässlich des Erscheinens ein virtuelles Leseprojekt initiiert, an dem ich mit sieben weiteren Bloggerinnen und Bloggern teilnehmen durfte.
Ich weiß nicht genau, welche Vorstellungen die anderen Teilnehmer oder der Verlag hatten, ich hatte anscheinend andere.
Zwar fand ich es interessant die Einzelbeiträge zu den Abschnitten zu lesen. Allerdings hatte ich mir eine stärkere Diskussionsfreudigkeit erhofft. Manchmal entwickelte sich ein Gespräch, bisweilen sogar ein Disput, was durchaus anregend war, aber mit dem Abzug einiger Teilnehmer abnahm.
Vielleicht hätte die Moderation durch den Verlag dies verbessern können. Auf viele Fragen und Anregungen wurde nicht eingegangen. Um ein solches Projekt sinnvoll durchzuführen, muss man Zeit investieren, sonst ist es für die Katz. Mit fehlender Zeit mag sich auch mein Eindruck begründen, daß nicht alle Blogger die Beiträge ihrer Kollegen gelesen haben.
Auch scheint mir WordPress nicht die ideale Form für ein derartiges Leseprojekt zu bieten. Einige außen stehende Leser haben sich bei mir über die Unübersichtlichkeit beklagt.
Für das Projekt finde ich das alles sehr schade, denn an sich war es eine sehr gute Idee.
Durch Aktion und Roman habe ich auf jeden Fall einen Einblick in südafrikanische Verhältnisse erhalten. Nicht zuletzt auch durch die im Blog geposteten Interviews mit Nadine Gordimer. Ihrem lebenslangen Anschreiben gegen soziale Ungerechtigkeit und politische Mißstände zolle ich großen Respekt, ihren Thesen begegne ich allerdings lieber im Interview oder Essay.
Liebe Atalante
Zum Roman selber kann ich nichts sagen, denn ich habe ihn nicht gelesen und werde es wohl auch nicht tun. Über Südafrika im Allgemeinen habe ich schon relativ viel gelesen und selbst in meiner Jugendzeit einiges mitbekommen, nicht zuletztt durch eine Südafrikanerin (Mischling), die in unserem Haus gewohnt hat, und durch geschäftliche Beziehungen durch meinen Vater.
Es braucht auch als Nichtteilnehmer am Projekt unglaublich viel Zeit, wenn man die Posts der beteiligten Blogger und die Kommentare verfolgen will. Ich habe nur wenige Male reingeschaut und dann wieder aufgehört mitzulesen. Es war mir einfach zu aufwändig. Denn in der Zeit, die ich am PC sitze, lese und kommentiere, geht mir wertvolle Lesezeit verloren.
Wenn man den entsprechenden Roman nicht selbst gelesen hat oder mitliest, dann ist das Interesse an einem begleitenden Leseprojekt nicht so groß. Immerhin hast Du die Anfänge verfolgt und Dich ja auch beteiligt.
Mich würde interessieren, ob Dein nachlassendes Interesse an dem Sujet oder an der speziellen Form des Diskussionsblogs lag.
Das hört sich so an als wäre dieses Buch nicht das, was ich persönlich von einer Nobelpreisträgerin erwarten würde. Der Satz, den Du in Deiner Rezension zitiert hast, ist für mich Grund genug von diesem Buch erst einmal Abstand zu nehmen. Denn nichts regt mich mehr auf als schlecht lektorierte Bücher, von denen es leider viel zu viele auf dem Markt gibt. Aber, und hier kann ich mich nur wiederholen, von einer Nadine Gordimer hätte ich das nicht erwartet.
LG, Katarina 🙂
Gordimer hat in einem ihrer jüngsten Interviews betont, daß sie ihre Bücher nie einem Lektor vorlege. Selbst ihrem Mann hatte sie diese bis zur Veröffentlichung vorenthalten. Der Stil ist folglich eine Folge ihres schriftstellerischen Selbstbewußtseins. Lektor und Verlag ist dies nicht vorzuwerfen.
Deine Erwartungshaltung gegenüber einer Nobelpreisträgerin ist verständlich, Katarina. Allerdings ist der Literatur-Nobelpreis immer auch ein politischer Preis. Vor wenigen Tagen hat sich dazu Per Wästberg, Mitglied des Komitees, im Büchermarkt des DLF geäußert, „Der rätselhafte Horizont des Nobelpreises”.
Da sieht man mal wie wichtig der Beruf des Lektors ist. Auf dem heutigen Buchmarkt werden ja immer mehr Self-Publisher erfolgreich, die oft gar nicht redigiert sind oder gar mehr als einen Entwurf schreiben. Aber auch wenn man als Schriftsteller talentiert ist, braucht man doch immer noch einen, der dafür ausgebildet ist den Wald zu sehen, wenn man selbst außer Bäumen nicht mehr viel wahrnimmt. 😉
Wie ich Dich beneide (ich weiß Neid ist ein Sünde)! Du und auch Mara habt diese Zeilen schon nieder geschrieben. Dazu fehlen mir momentan die Nerven. Vielleicht lass ich es noch ein wenig sacken und beschere dem Berlin Verlag im neuen Jahr einen Beitrag. Bzgl. der Zeit hatte ich wirklich nicht ganz auf dem Schirm was mich erwartet. Das Buch lesen, einen Beitrag aller 2 Tage schreiben, sieben Beiträge von den anderen Paten lesen und ggf. noch Kommentare posten. Mit diesem Projekt hätte ich mich glatt selbstständig machen können. Das war zuviel. Für Außenstehende, und ich habe auch mit vielen darüber gesprochen, ist es einfach nicht interessant acht Beiträge zu jedem Absatz zu lesen. Höchstens noch, wenn man selbst das Buch liest aber neue Leserschaften (und das war sicher auch ein Ziel vom Verlag) gewinnt man dadurch nicht.
Am Ende hatte ich mich schon fast an Gordimers Stil gewöhnt und Jabu und Steve bekamen ganz langsam Züge aber trotzdem ist das Buch für mich (leider) durchgefallen. Die Thematik an sich hat mich sehr interessiert. Schade
Dein Resümee werde ich mit Interesse lesen, egal wann es erscheint.
Die richtige Form einer solchen Unternehmung zu finden, ist wirklich nicht einfach. Sie ist von so vielen Dingen abhängig, die sich manchmal ganz anders entpuppen als geahnt.
Ich erinnere mich an derartige Leseprojekte, die sehr gut liefen, weil die Motivation am Text sehr hoch war, weil alle einzuschätzen wussten, welcher Text auf sie zukommt und weil der Text nicht übermässig lang war. Je höher die Seitenzahl, desto höher die Verlustquote.
Andere Unternehmungen, wie sie auch heute noch auf diversen Plattformen laufen, bestehen aus viel Palaver um die Beschaffung des Textes, bevor dann der Wettbewerb über die bereits bewältigten Seitenmengen startet. Alles Metakram, über die vorliegende Literatur wird wenig diskutiert.
Auch im realen Literaturkreis, etwas ähnliches möchte ein solches Leseprojekt ja auch sein, besteht immer die Gefahr, vom Rand des Textes in Geplauder abzurutschen, das am Ende des Abends vielleicht ganz nett war, aber mehr auch nicht.
Die Zeit war das Problem, auch der Verlagsblogger wird nicht soviel zur Verfügung gestellt bekommen haben, wie er vielleicht gerne gehabt hätte. Das Ganze ist ja eine finanzielle Frage. Wenn es keine wäre, hätte man bei diesem Projekt folgende „Blogger” engagieren können, eine Politologin, eine Historikerin, eine Ethnologin, eine Südafrikanerin, die Übersetzerin, den Lektor (den es im Geheimen sicherlich doch gibt) und eine Literaturwissenschaftlerin. Aber wen hätte dann noch die Meinung von uns Bloggern interessiert? 😉 Okay, wenn man sich die Statistik ansieht, genauso viele wie jetzt. 😉
Liebe Atalante
Wahrscheinlich liegt es an beidem, am Diskussionsblog und am Buch. Ich hatte einfach keine Lust mehr, meine Zeit in etwas zu investieren, das mich nicht wirklich mitreisst. Für das Buch, nachdem ich mitbekommen hatte, dass es die meisten nicht mögen, hatte ich dann auch kein Interesse mehr. Ich bin froh, dass ich beim Projekt nicht eingestiegen bin, nachdem ich jetzt noch den Kommentar von der Bücherliebhaberin gelesen habe.